Dienstag, 7. August 2007
Das Leben als solches
Dienstag, 7. August 2007, Kategorie: 'Krankengeschichten'
Geschafft! Heute morgen hatte ich meine letzte Bestrahlung. Die Assistentinnen verabschiedeten sich herzlich von mir. Wir wollen uns nicht wiedersehen. Bei der Sozialarbeiterin unterschrieb ich einen Antrag auf Anschlussheilbehandlung. Wenn es der Rententräger genehmigt, werde ich nach Lohmen an den Garder See fahren. Das liegt in Mecklenburg unweit des Ortes, wo mein Neffe mit seiner Mutter lebt. Ich vermute mal, sie werden mich besuchen, wie sie es schon in Plau am See taten. Sonst sehen wir uns ja eher selten.
Ich habe mit erschrecken festgestellt, dass ich meine letzte Podcastepisode vor fast zwei Monaten hochgeladen hatte. Der Artikel aus dem Blog erschien vor zwei Wochen. Keine Angst, ich habe weder an dem einen noch an dem anderen die Lust verloren. Nur, eine Folge der Bestrahlung war die Müdigkeit, und ich hatte wenig Lust am Abend zu schreiben. Mit meinem üblichen Tagwerk war ich genug beschäftigt.
Darmkrebs, Lebermetastase, Brustkrebs, ich fühlte mich dem allen hilflos ausgeliefert. Wie jetzt weiter? Auf der Suche nach einer Antwort, habe ich mir mehrere Bücher bestellt. Eins davon, "Heilungschancen bei Krebs. Wegweiser im Krankheitsfall" gab ich meiner Freundin Beate. Ich sagte ihr, ich könnte das Buch im Moment nicht im Hause haben. Es würde mich zu sehr deprimieren. Der Autor empfiehlt für die, die sich das leisten können, IPT, eine Insulin induzierte Chemotherapie.
Seine Therapie für Arme heißt Breuß-Diät. Dabei nimmt der Kranke 42 Tage nur Kräutertees und Fruchtsäfte zu sich. Ziel ist es den Krebs auszuhungern. Im Netz gibt es eine Webseite eines dankbaren Patienten, der mithilfe dieser Diät seinen Prostatakrebs geheilt haben will. An dieser Art von Krebs leide ich nicht. Infolge meines niedrigen Blutdrucks habe ich auch so Kreislaufprobleme. Hungern würde das noch verschärfen. Meine 60 kg, die ich jetzt wiege, habe ich mir mühsam erkämpft. Laut des Prostatakrebspatienten erklärt Beuß:
Während der Reha in Plau hatte ich das erste Mal etwas über Visualisierung gehört. Ich hatte mir daraufhin das Buch "Den Krebs abwehren - die Selbstheilung fördern" von Dr. Christine Centurioni, einer Psychoonkologin aus Österreich besorgt. Das Buch enthält zwei CDs. Die Übung zur Unterstützung der Strahlentherapie habe ich in meinen Tagesablauf eingebaut. Weil ich merkte, dass mir das gut bekam, habe ich zwei weitere Bücher über Visualisierung gekauft. Der Psychologe in Plau meinte ja, ich wäre für so etwas empfänglich. Es handelt sich um die Titel "Wieder gesund werden. Eine Anleitung zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte für Krebspatienten und ihre Angehörigen" sowie "Auf dem Wege der Besserung. Schritte zur körperlichen und spirituellen Heilung" Autor ist der amerikanische Onkologe und Strahlentherapeut O. C. Simonton. "Wieder gesund werden" habe ich inzwischen gelesen, beim anderen Buch bin ich bei den Patientenbriefen angelangt.
Seitdem geht es mir besser und ich fühle mich keineswegs mehr hoffnungslos. Jeder Krebskranke muss seine Mittel zur Bewältigung der Krankheit aufspüren. Ich glaube für mich den Weg gefunden zu haben, mit meiner Erkrankung und ihren Folgen leben zu können. Visualisierung bzw. Imagination wird das Thema meines nächsten Artikels in der Rubrik Krankengeschichten sein. Es ist für mich nicht nur eine Strategie mit dem Krebs fertig zu werden. Ich habe auch die Antwort auf eine Frage erhalten, die ich mir eigentlich gar nicht gestellt hatte: Warum gerade ich?
Ein anderes Problem hart noch immer einer Lösung. Meine Rückseite hat mich in der letzten Woche wieder kräftig sabotiert. Um meine Ausscheidungen charakterfest zu machen, rühre ich mir täglich einen Teelöffel indische Flohsamenschalen in den Joghurt. Wenn die aufgequollen sind, haben sie die Konsistenz von Plastekügelchen und schmecken auch so, also mehr was für die Müsli- und Tofufraktion aber nichts für mich. Ich stopfe sie trotzdem heldenhaft in mich hinein. Mein Onkologe hatte bei der letzten Hinternschau bestätigt, meine Absonderungen wären etwas fester. Aber das Gleichgewicht ist ein sehr fragiles. Kirschsaft musste ich jetzt von meiner Nahrungsmittelliste streichen. Himbeeren und Johannisbeeren hingegen vertrage ich gut. Nur gemuste Äpfel oder Bananen zu verzehren, ist mir auf Dauer doch zu eintönig. Aber bei meinen Essensexperimenten muss ich sehr vorsichtig sein, will ich nicht für unbestimmte Zeit auf dem stillen Örtchen festsitzen.
Ich habe mit erschrecken festgestellt, dass ich meine letzte Podcastepisode vor fast zwei Monaten hochgeladen hatte. Der Artikel aus dem Blog erschien vor zwei Wochen. Keine Angst, ich habe weder an dem einen noch an dem anderen die Lust verloren. Nur, eine Folge der Bestrahlung war die Müdigkeit, und ich hatte wenig Lust am Abend zu schreiben. Mit meinem üblichen Tagwerk war ich genug beschäftigt.
Das Leben als solches endet oft tödlich, aber was machen wir bis dahin?Fragt mein Lieblingskabarettist Georg Schramm als Oberstleutnant Sanftleben in " Neues aus der Anstalt ". Ich, für meinen Teil, arbeite an einem Plan B. Plan A wäre gewesen nach dem Sommer wieder stundenweise zu arbeiten. Mit der Diagnose Brustkrebs hatte sich dies erledigt. Ich hatte geglaubt, ich könnte meinen Krebs überstehen, ohne etwas an meinem Leben verändern zu müssen. Inzwischen weiß ich, dass ich mich da geirrt habe. Damit meine ich nicht, meine Auffassung vom Leben sondern von meiner Erkrankung. Was Krebs für mich bedeutet, und wie ich damit umzugehen habe, um nicht aus lauter Angst in Verzweiflung unterzugehen.
Darmkrebs, Lebermetastase, Brustkrebs, ich fühlte mich dem allen hilflos ausgeliefert. Wie jetzt weiter? Auf der Suche nach einer Antwort, habe ich mir mehrere Bücher bestellt. Eins davon, "Heilungschancen bei Krebs. Wegweiser im Krankheitsfall" gab ich meiner Freundin Beate. Ich sagte ihr, ich könnte das Buch im Moment nicht im Hause haben. Es würde mich zu sehr deprimieren. Der Autor empfiehlt für die, die sich das leisten können, IPT, eine Insulin induzierte Chemotherapie.
Seine Therapie für Arme heißt Breuß-Diät. Dabei nimmt der Kranke 42 Tage nur Kräutertees und Fruchtsäfte zu sich. Ziel ist es den Krebs auszuhungern. Im Netz gibt es eine Webseite eines dankbaren Patienten, der mithilfe dieser Diät seinen Prostatakrebs geheilt haben will. An dieser Art von Krebs leide ich nicht. Infolge meines niedrigen Blutdrucks habe ich auch so Kreislaufprobleme. Hungern würde das noch verschärfen. Meine 60 kg, die ich jetzt wiege, habe ich mir mühsam erkämpft. Laut des Prostatakrebspatienten erklärt Beuß:
daß sogenannte Mißerfolge meiner Kuranwendung sich nur dann einstellen, wenn meine Kur nicht in allen Punkten strikt eingehalten wurdeMit anderen Worten, wenn ich durch diese Diät nicht geheilt werde, dann bin ich selber schuld. Diese Aussage ist vollständig geeignet, mich vorm Ausprobieren der Breuß-Diät abzuhalten.
Während der Reha in Plau hatte ich das erste Mal etwas über Visualisierung gehört. Ich hatte mir daraufhin das Buch "Den Krebs abwehren - die Selbstheilung fördern" von Dr. Christine Centurioni, einer Psychoonkologin aus Österreich besorgt. Das Buch enthält zwei CDs. Die Übung zur Unterstützung der Strahlentherapie habe ich in meinen Tagesablauf eingebaut. Weil ich merkte, dass mir das gut bekam, habe ich zwei weitere Bücher über Visualisierung gekauft. Der Psychologe in Plau meinte ja, ich wäre für so etwas empfänglich. Es handelt sich um die Titel "Wieder gesund werden. Eine Anleitung zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte für Krebspatienten und ihre Angehörigen" sowie "Auf dem Wege der Besserung. Schritte zur körperlichen und spirituellen Heilung" Autor ist der amerikanische Onkologe und Strahlentherapeut O. C. Simonton. "Wieder gesund werden" habe ich inzwischen gelesen, beim anderen Buch bin ich bei den Patientenbriefen angelangt.
Seitdem geht es mir besser und ich fühle mich keineswegs mehr hoffnungslos. Jeder Krebskranke muss seine Mittel zur Bewältigung der Krankheit aufspüren. Ich glaube für mich den Weg gefunden zu haben, mit meiner Erkrankung und ihren Folgen leben zu können. Visualisierung bzw. Imagination wird das Thema meines nächsten Artikels in der Rubrik Krankengeschichten sein. Es ist für mich nicht nur eine Strategie mit dem Krebs fertig zu werden. Ich habe auch die Antwort auf eine Frage erhalten, die ich mir eigentlich gar nicht gestellt hatte: Warum gerade ich?
Ein anderes Problem hart noch immer einer Lösung. Meine Rückseite hat mich in der letzten Woche wieder kräftig sabotiert. Um meine Ausscheidungen charakterfest zu machen, rühre ich mir täglich einen Teelöffel indische Flohsamenschalen in den Joghurt. Wenn die aufgequollen sind, haben sie die Konsistenz von Plastekügelchen und schmecken auch so, also mehr was für die Müsli- und Tofufraktion aber nichts für mich. Ich stopfe sie trotzdem heldenhaft in mich hinein. Mein Onkologe hatte bei der letzten Hinternschau bestätigt, meine Absonderungen wären etwas fester. Aber das Gleichgewicht ist ein sehr fragiles. Kirschsaft musste ich jetzt von meiner Nahrungsmittelliste streichen. Himbeeren und Johannisbeeren hingegen vertrage ich gut. Nur gemuste Äpfel oder Bananen zu verzehren, ist mir auf Dauer doch zu eintönig. Aber bei meinen Essensexperimenten muss ich sehr vorsichtig sein, will ich nicht für unbestimmte Zeit auf dem stillen Örtchen festsitzen.
Montag, 16. Juli 2007
Alarm im Treppenhaus
Montag, 16. Juli 2007, Kategorie: 'Krankengeschichten'
Bei meinem letzten Besuch beim Phlebologen hatte ich es günstig getroffen. Meine alte Nachbarin vom Erdgeschoss hatte nach mir einen Termin in der Praxis. So kutschierte uns ihr Schwiegersohn, während Tochter und Enkel ihre Wohnung hüteten. Mit dem Taxifahrer hatte ich am Tag zuvor ausgemacht, dass er mich von der Arztpraxis abholt. Er wäre auf dem Weg zu meiner Wohnung sowieso dort vorbeigekommen. Der vereinbarte Zeitpunkt verstrich, ohne dass das Taxi erschien. Nach einer Viertelstunde bat ich die Schwester beim Taxiunternehmen anzurufen. Es dauerte noch eine ganze Weile bis das Fahrzeug endlich vor der Tür stand. Am Steuer saß aber nicht der Chef, der mich sonst fuhr, sondern mein Lieblingsfahrer. Seine Frau hat denselben Arbeitgeber wie ich. Seine Kusine ist die alte Dame, die unter mir wohnt, und die durch Krebs sowohl Mann als auch Sohn verloren hat. Dieser Fahrer nimmt regen Anteil an meinem Schicksal. Er war sichtlich aufgewühlt, meinetwegen, aber ohne meine Schuld.
Der Chef des Taxiunternehmens hatte kurzfristig eine andere Tour übernommen. Mein Lieblingsfahrer erhielt den Auftrag mich zur Strahlentherapie zu verfrachten. Allerdings vergaß der Chef zu erwähnen, dass ich in der Arztpraxis wartete. Ich hatte mit den Fahrern einen Code vereinbart, eben weil ich ja allein lebe. Wenn sie klingeln, gehe ich zur Wechselsprechanlage und erkläre, dass ich gleich käme. So wissen sie, alles ist in Ordnung, und warten, bis ich komme. Mein Taxifahrer nun war in Sorge, weil ich auf sein Läuten nicht reagierte. Die Nachbarn oben ließen ihn ins Haus wussten aber nicht, wo ich war. Er klopfte an meine Wohnungstür, und ich antwortete immer noch nicht. Also rief er den Rettungsdienst. Die kamen, wie er mir berichtete, auch mit Blaulicht ruck zuck angebraust. Nun waren sie zwar mehr Leute, aber in meine Wohnung brachte sie das immer noch nicht. Deshalb entschlossen sie sich, die Polizei zu holen. Inzwischen hatte ich aber beim Taxichef anrufen lassen. Dem fielen daraufhin alle seine Sünden ein. Er informierte seinen Mitarbeiter, wo ich auf ihn wartete. So wurde das ganze Manöver dann abgeblasen, bevor die Polizei anrückte und meine Wohnungstür aufbrach. Der Chef hat sich am anderen Tag bei mir entschuldigt, ob auch bei seinem Mitarbeiter, weiß ich nicht. Ich habe mich bei dem Taxifahrer bedankt, auch wenn seine Aufregung zum Glück umsonst war.
Ich hatte diese Woche meine 17. Bestrahlung, Bergfest sozusagen. In der Umkleidekabine muss ich manchmal warten, wenn die Sanitäter stationäre Patienten bringen. "Frauen gegenüber bin ich immer ganz wehrlos." hörte ich eine Männerstimme schmachten. Was wäre denn das, wollte ich von der Assistentin wissen. Sollte das eine Aufforderung an die Anwesenden weiblichen Geschlechts sein über diesen Mann herzufallen? Die Assistentin ließ die Tür einen Spalt offen und wies kurz auf einen der beiden Sanitäter, die eine Trage schoben. Sie sagte mir, bei medizinisch Tätigen erwarte sie eigentlich immer, dass jedermann ohne Aufforderung zupacke, sozusagen von Berufs wegen. Dieser Herr da hätte nur daneben gestanden, als sie und ihre Kollegin den Patienten von der Liege auf den Tisch umbetteten. So einen möchte sie nicht zu Hause haben, stellte sie klar. Ich lehnte gleichfalls dankend ab. Aber nun wüsste ich ja, wie der Wehrlose aussähe, fügte ich hinzu. Die Assistentin musste lachen. Draußen, während ich zu meinem Taxi ging, musterte mich ein Mann interessiert. Der Blick tat mir gut, endlich mal als Frau und nicht nur als Kranke wahrgenommen zu werden.
Das Team in der physiotherapeutischen Praxis wird seit kurzem von einer Praktikantin verstärkt. Meine Therapeutin hatte in der Behandlungskabine für sie ein Schaubild über das Lymphsystem aufgehängt. So bekam ich kostenlos Informationen mitgeliefert. Eine Kollegin betrat die Kabine, während meine Therapeutin mein Lymphsystem in Schwung brachte. Die andere Therapeutin begann uns die männliche Figur auf dem Schaubild zu erläutern. Sie zeigte aufs rechte Ohr und wechselte dann aufs linke. Danach verdeckte sie mit ihrer Hand die Stelle zwischen den Beinen. Darüber wolle sie nicht sprechen. Wieso, wollte ich wissen, ab da wäre es doch erst interessant. Meine Therapeutin gab mir recht. Ihre Kollegin verdrehte die Augen und flüchtete aus der Kabine. Wir anderen beiden prusteten los. Für die nächste Zeit muss ich auf Weiterbildung in dieser Praxis verzichten. Meine Therapeutin hat jetzt drei Wochen Urlaub.
Am Montag hatte ich ein Date in der onkologischen Sprechstunde. Ich durfte mich gleich nach der Begrüßung auf die Pritsche legen. Die Sonographie ergab keine Metastasen in der Leber. Mein Onkologe streifte sich nach dem Ultraschall die Gummihandschuhe über und griff nach einer Dose. Ich wusste, was das hieß, Darmuntersuchung! Der Tag hatte für mich durch eine Erkältung schon unerfreulich mit Kopfschmerzen begonnen. Er sollte noch unerfreulicher enden. Diese Untersuchung war ungeeignet meine ohnehin schon miese Laune zu heben. Ich fragte meinen Doktor, ob er mir den Tag nun völlig verderben wolle. Er antwortete, ich solle ihn seine Arbeit tun und ansonsten alles schön locker lassen. Die Stellung unverkrampft zu halten fiel mir schwer. Von allen Ärzten, die mir in der letzten Zeit in den Hintern geguckt haben, war dieser der vorsichtigste. Angenehm war die Sache damit noch lange nicht. Es tat nur weniger weh.
Nach der Untersuchung erkundigte er sich nach meinem Darm. Es wäre doch alles in bester Ordnung oder? Was sollte ich darauf nun noch erwidern? Mein Hintern ist mein größtes Problem! Jedesmal, wenn ich in der onkologischen Sprechstunde war, hatte ich über meine Inkontinenz gejammert. Ich hatte erzählt, dass ich ohne Windeln nicht aus dem Haus gehe. Und nun solche Frage, die beste Grundlage für ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis ist noch immer gegenseitiges Missverstehen. Zu meinen rückseitigen Problemen will sich mein Doktor erst nach der Darmspiegelung äußern. Die von mir heißgeliebte Untersuchung werde ich dann nach der Strahlentherapie bekommen.
Der Ulltraschall des Bauchraums blieb zwar ohne Befund, der Tumormarkertest dafür nicht. Die Schwester sagte mir am Telefon, ich solle nicht erschrecken. Am Mittwoch muss ich in die Röhre. Das Ergebnis steht etwa zwei bis drei Tage später fest. Mein Onkologe hat dann Urlaub. Ich kann unmöglich drei Wochen warten! Die Schwester hat mir versprochen, sobald der Befund vorliegt, erhalte ich Bescheid. Das wird ausgerechnet in die Woche fallen, in der ich Geburtstag habe, tolles Geschenk.
Der Chef des Taxiunternehmens hatte kurzfristig eine andere Tour übernommen. Mein Lieblingsfahrer erhielt den Auftrag mich zur Strahlentherapie zu verfrachten. Allerdings vergaß der Chef zu erwähnen, dass ich in der Arztpraxis wartete. Ich hatte mit den Fahrern einen Code vereinbart, eben weil ich ja allein lebe. Wenn sie klingeln, gehe ich zur Wechselsprechanlage und erkläre, dass ich gleich käme. So wissen sie, alles ist in Ordnung, und warten, bis ich komme. Mein Taxifahrer nun war in Sorge, weil ich auf sein Läuten nicht reagierte. Die Nachbarn oben ließen ihn ins Haus wussten aber nicht, wo ich war. Er klopfte an meine Wohnungstür, und ich antwortete immer noch nicht. Also rief er den Rettungsdienst. Die kamen, wie er mir berichtete, auch mit Blaulicht ruck zuck angebraust. Nun waren sie zwar mehr Leute, aber in meine Wohnung brachte sie das immer noch nicht. Deshalb entschlossen sie sich, die Polizei zu holen. Inzwischen hatte ich aber beim Taxichef anrufen lassen. Dem fielen daraufhin alle seine Sünden ein. Er informierte seinen Mitarbeiter, wo ich auf ihn wartete. So wurde das ganze Manöver dann abgeblasen, bevor die Polizei anrückte und meine Wohnungstür aufbrach. Der Chef hat sich am anderen Tag bei mir entschuldigt, ob auch bei seinem Mitarbeiter, weiß ich nicht. Ich habe mich bei dem Taxifahrer bedankt, auch wenn seine Aufregung zum Glück umsonst war.
Ich hatte diese Woche meine 17. Bestrahlung, Bergfest sozusagen. In der Umkleidekabine muss ich manchmal warten, wenn die Sanitäter stationäre Patienten bringen. "Frauen gegenüber bin ich immer ganz wehrlos." hörte ich eine Männerstimme schmachten. Was wäre denn das, wollte ich von der Assistentin wissen. Sollte das eine Aufforderung an die Anwesenden weiblichen Geschlechts sein über diesen Mann herzufallen? Die Assistentin ließ die Tür einen Spalt offen und wies kurz auf einen der beiden Sanitäter, die eine Trage schoben. Sie sagte mir, bei medizinisch Tätigen erwarte sie eigentlich immer, dass jedermann ohne Aufforderung zupacke, sozusagen von Berufs wegen. Dieser Herr da hätte nur daneben gestanden, als sie und ihre Kollegin den Patienten von der Liege auf den Tisch umbetteten. So einen möchte sie nicht zu Hause haben, stellte sie klar. Ich lehnte gleichfalls dankend ab. Aber nun wüsste ich ja, wie der Wehrlose aussähe, fügte ich hinzu. Die Assistentin musste lachen. Draußen, während ich zu meinem Taxi ging, musterte mich ein Mann interessiert. Der Blick tat mir gut, endlich mal als Frau und nicht nur als Kranke wahrgenommen zu werden.
Das Team in der physiotherapeutischen Praxis wird seit kurzem von einer Praktikantin verstärkt. Meine Therapeutin hatte in der Behandlungskabine für sie ein Schaubild über das Lymphsystem aufgehängt. So bekam ich kostenlos Informationen mitgeliefert. Eine Kollegin betrat die Kabine, während meine Therapeutin mein Lymphsystem in Schwung brachte. Die andere Therapeutin begann uns die männliche Figur auf dem Schaubild zu erläutern. Sie zeigte aufs rechte Ohr und wechselte dann aufs linke. Danach verdeckte sie mit ihrer Hand die Stelle zwischen den Beinen. Darüber wolle sie nicht sprechen. Wieso, wollte ich wissen, ab da wäre es doch erst interessant. Meine Therapeutin gab mir recht. Ihre Kollegin verdrehte die Augen und flüchtete aus der Kabine. Wir anderen beiden prusteten los. Für die nächste Zeit muss ich auf Weiterbildung in dieser Praxis verzichten. Meine Therapeutin hat jetzt drei Wochen Urlaub.
Am Montag hatte ich ein Date in der onkologischen Sprechstunde. Ich durfte mich gleich nach der Begrüßung auf die Pritsche legen. Die Sonographie ergab keine Metastasen in der Leber. Mein Onkologe streifte sich nach dem Ultraschall die Gummihandschuhe über und griff nach einer Dose. Ich wusste, was das hieß, Darmuntersuchung! Der Tag hatte für mich durch eine Erkältung schon unerfreulich mit Kopfschmerzen begonnen. Er sollte noch unerfreulicher enden. Diese Untersuchung war ungeeignet meine ohnehin schon miese Laune zu heben. Ich fragte meinen Doktor, ob er mir den Tag nun völlig verderben wolle. Er antwortete, ich solle ihn seine Arbeit tun und ansonsten alles schön locker lassen. Die Stellung unverkrampft zu halten fiel mir schwer. Von allen Ärzten, die mir in der letzten Zeit in den Hintern geguckt haben, war dieser der vorsichtigste. Angenehm war die Sache damit noch lange nicht. Es tat nur weniger weh.
Nach der Untersuchung erkundigte er sich nach meinem Darm. Es wäre doch alles in bester Ordnung oder? Was sollte ich darauf nun noch erwidern? Mein Hintern ist mein größtes Problem! Jedesmal, wenn ich in der onkologischen Sprechstunde war, hatte ich über meine Inkontinenz gejammert. Ich hatte erzählt, dass ich ohne Windeln nicht aus dem Haus gehe. Und nun solche Frage, die beste Grundlage für ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis ist noch immer gegenseitiges Missverstehen. Zu meinen rückseitigen Problemen will sich mein Doktor erst nach der Darmspiegelung äußern. Die von mir heißgeliebte Untersuchung werde ich dann nach der Strahlentherapie bekommen.
Der Ulltraschall des Bauchraums blieb zwar ohne Befund, der Tumormarkertest dafür nicht. Die Schwester sagte mir am Telefon, ich solle nicht erschrecken. Am Mittwoch muss ich in die Röhre. Das Ergebnis steht etwa zwei bis drei Tage später fest. Mein Onkologe hat dann Urlaub. Ich kann unmöglich drei Wochen warten! Die Schwester hat mir versprochen, sobald der Befund vorliegt, erhalte ich Bescheid. Das wird ausgerechnet in die Woche fallen, in der ich Geburtstag habe, tolles Geschenk.
Mittwoch, 27. Juni 2007
Die erste Dosis
Mittwoch, 27. Juni 2007, Kategorie: 'Krankengeschichten'
Unter der Schlagzeile Agentur für Arbeit hat 5,5 Milliarden Euro übrig, freute sich Alfred Boss vom Kieler Institut für Weltwirtschaft in der Welt am Sonntag über den Überschuss. Wie eine Bundesagentur Geld "erwirtschaften" kann, durfte ich im Frühjahr als Leistungsberechtigte am eigenen Leib erfahren. Halbtote werden dann kurzerhand von sogenannten Amtsärzten per Ferndiagnose als voll arbeitsfähig eingestuft. Mir wäre in meinem Fall das ALG I gestrichen worden, obwohl ich darauf nach Ablauf des Krankengeldes Anspruch gehabt hätte, bis mir die Erwerbsminderungsrente zugesprochen wurde. Der Agentur für Arbeit war auch bekannt, dass ich bereits einen Termin beim Arzt des Rentenversicherers hatte. Wenn dann trotzdem von dieser Agentur ein Gutachten nach Aktenlage erstellt wird, das mir konsequent die zustehende Leistung aberkennt, dann war das Absicht. Nur der gleichzeitig eingetroffene Rentenbescheid bewahrte mich vor einer Klage vorm Sozialgericht und vor dem Verlust der Krankenversicherung. Das Ergebnis des Bescheides ist bekannt. Ich kann täglich nur zwei Stunden arbeiten, weil ich voll erwerbsgemindert bin. Meine jetzt amtlich bestätigte Schwerbeschädigung beträgt 90%.
Für die Agentur für Arbeit bin ich nur eine Simulantin. Selbstverständlich war ich ein bedauerlicher Einzelfall, einer von vielen, wie die Mitarbeiter der Agentur bestätigten. Sie redeten sich übrigens damit heraus, dass sie keine Ärzte wären und nicht anders entscheiden könnten, als mir das ALG zu entziehen. Vom gesunden Menschenverstand war keine Rede. Na immerhin lässt sich so ein bisschen Geld sparen, und die Statistik sieht auch etwas netter aus, wenn man die Anspruchsberechtigten hinausdrängelt. Oder wenn man die Arbeitsuchenden erst gar nicht als solche zählt. Frisieren sollte besser den Haarkünstlern überlassen bleiben. Das Verkünden der Arbeitslosenzahlen und die Erfolgsmeldungen erinnern groteskerweise an die Jubelberichte der Aktuellen Kamera über die monatliche Planerfüllung.
In einem Kommentar hatte jemand entsetzt geäußert, so langsam beschleiche ihn der begründete Verdacht, nicht die BRD habe die DDR übernommen, sondern es sei eher genau umgekehrt. Zumindest das Aufhübschen der Statistik der Arbeitslosenzahlen ließe sich verhindern. Dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages liegt ein Antrag vor, der genau das erreichen soll, eine ungeschönte Statistik. Eingereicht hat die Petition "Bundesagentur für Arbeit: Zahl der Arbeitslosen" Naomi-Pia Witte von den Linken am 22. Mai 2007. Bis jetzt, wo ich dies schreibe, haben 6.876 Bundesbürger, einschließlich mir selbst unterzeichnet. Das reicht aber bei weitem nicht, notwendig sind 50.000 Unterschriften.
Ich bitte Euch, die Ihr mein Blog lest oder meinen Podcast hört, unterstützt diese Petition, folgt dem Link, und tragt Euch als Mitzeichner ein. Ob es gelingt bis zum 16. Juli die erforderlichen Stimmen zusammenzubekommen, ist fraglich. Aber lasst es uns wenigstens vesuchen! Es wäre hilfreich, wenn sich mindestens eines der Alphatiere der Blogosphäre dieser Sache vehement annehmen würde. Nur einen Link zu setzen, ist nicht genug. Ich bin immer noch der Meinung, richtige Macht hätten wir Blogger erst, wenn wir Gesetze durchsetzen oder verhindern können. Hier wäre die Gelegenheit, es zu beweisen. Ich kann diese Sache aus zwei Gründen nicht selbst in die Hand nehmen:
1. Mein Weblog Nordlichter hat nur 20 Besucher am Tag.
2. Ich bin seit Donnerstag mit der Strahlentherapie beschäftigt.
Wer solcher Art Therapie nach einer Krebsoperation hinter sich hatte, der weiß, man kommt in der Zeit kaum zu etwas anderem. Am Donnerstag wurde es nun ernst, ich fuhr mit dem Taxi nach Greifswald zur Strahlentherapie. Statt der Stühle wie vor zwei Jahren war der Warteraum jetzt mit hässlichen blauen Klubsesseln vollgestellt. Bequemer saß ich darin nicht, ich kam mir noch verlorener vor. Die Dame an der Annahme konnte sich an mich erinnern. Im Gegensatz zur ersten Bestrahlungstherapie musste ich mich nun oberhalb des Nabels entblößen, bevor ich auf die Pritsche kletterte. Diesmal lag ich auf dem Rücken die Arme über dem Kopf verschränkt. Die Assistentin zerrte das bunte Badetuch mit mir darauf in die richtige Position und verschwand dann hinter der Tür.
Da lag ich nun allein auf meinem Badetuch die Strahlenkanone im Blick. Ich hätte gut jemand gebrauchen können, der meine Hand hielt. Aber es war niemand da. Das Gerät schwebte drohend über mir. Plötzlich rannen Tränen über mein Gesicht, ohne dass ich schluchzen musste, und ohne dass ich es verhindern konnte. Weil ich auf dem Rücken lag und mich nicht bewegen durfte, lief mir das Wasser rechts und links in die Ohren. Johnny Logan sang passenderweise "hold me now, don't cry". Ich konnte trotzdem nicht aufhören meine Ohren zu wässern, obwohl es doch erst die Simulation war und noch nicht die richtige Bestrahlung. Ich musste mir die Seen aus den Horchlöffeln wischen.
Anschließend konnte ich mich wieder anziehen und im Wartesaal platzieren. Ich wurde in die Kabine eins gebeten. Dort diente ein Klappbrett neben der Tür gleichzeitig als Sperre und Sitz. Vor zwei Jahren, als mein Bauch behandelt wurde, brauchte ich in keine Kabine zu gehen. Ich durfte mich direkt am Bestrahlungsgerät entblättern. Weil ich jetzt über ein kleines Stück Flur gehen musste, drapierte ich mein Badetuch wie eine Toga über die Schultern. Die Assistentin erkannte mich wieder. "Frau T., ich hatte Ihnen doch gesagt, ich will sie hier nicht mehr sehen." Ich war ja nicht freiwillig gekommen. Vor zwei Jahren hatte ich auf dem Bauch liegend das Geschütz kam gesehen sondern mehr gehört. Jetzt hatte ich es voll im Blick. Bei der Bestrahlung lag mein Kopf nach links geneigt. So flutete ich mein linkes Ohr.
Die körperliche Verwundung ist die eine Seite die seelische die andere. Auch wenn ich nicht rumjammerte, sah die Assistentin natürlich, was mit mir los war. Ob ich reden wolle? Bei der Strahlentherapie werden täglich dutzende von Patienten durchgeschleust, trotzdem ist man hier keine Nummer. Es ist kein Behandeln nur nach Dienstvorschrift. Während der langen Zeit meiner Erkrankung habe ich mich hier immer gut aufgehoben gefühlt, genauso wie bei den Schwestern in der Intensivstation und der Onkologie im Demminer Kreiskrankenhaus. Was man als Patient sucht, ist genau dies, Hilfe und Verständnis. Aber reden wollte ich dennoch nicht. Ich wäre dann in Tränen zerflossen.
Heute nach der vierten Bestrahlung fragte mich die Assistentin nochmals, wie ich mich fühle. Besser, die ersten beiden Tage waren besonders schlimm. Da kam alles wieder hoch. Dass ich das Gerät sehe, ist für mich eine zusätzliche Pein. Die Assistentin zeigte mir ihr Einfühlungsvermögen. Wann immer ich reden oder zum Wasserfall mutieren wolle, bräuchte ich es nur zu sagen. Ich weiß das, alleine dass es diese Möglichkeit gibt, hilft mir. Ansonsten fangen meine beiden Freundinnen hier, die mich anrufen und besuchen, das meiste ab. Ich bin froh, dass sie mir immer noch beistehen.
In einem Monat habe ich Geburtstag. Das wird dann die dritte bescheidene Feier in steter Folge werden. Bei der ersten wurde ich nach der Darmoperation aus dem Krankenhaus entlassen, bei der zweiten lag ich mit der Chemopumpe um den Hals in der Onkologie, und jetzt erhalte ich meine Strahlendosis als Geschenk. Vielen Dank, Herr Krebs! Ich habe die Nase voll.
Für die Agentur für Arbeit bin ich nur eine Simulantin. Selbstverständlich war ich ein bedauerlicher Einzelfall, einer von vielen, wie die Mitarbeiter der Agentur bestätigten. Sie redeten sich übrigens damit heraus, dass sie keine Ärzte wären und nicht anders entscheiden könnten, als mir das ALG zu entziehen. Vom gesunden Menschenverstand war keine Rede. Na immerhin lässt sich so ein bisschen Geld sparen, und die Statistik sieht auch etwas netter aus, wenn man die Anspruchsberechtigten hinausdrängelt. Oder wenn man die Arbeitsuchenden erst gar nicht als solche zählt. Frisieren sollte besser den Haarkünstlern überlassen bleiben. Das Verkünden der Arbeitslosenzahlen und die Erfolgsmeldungen erinnern groteskerweise an die Jubelberichte der Aktuellen Kamera über die monatliche Planerfüllung.
In einem Kommentar hatte jemand entsetzt geäußert, so langsam beschleiche ihn der begründete Verdacht, nicht die BRD habe die DDR übernommen, sondern es sei eher genau umgekehrt. Zumindest das Aufhübschen der Statistik der Arbeitslosenzahlen ließe sich verhindern. Dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages liegt ein Antrag vor, der genau das erreichen soll, eine ungeschönte Statistik. Eingereicht hat die Petition "Bundesagentur für Arbeit: Zahl der Arbeitslosen" Naomi-Pia Witte von den Linken am 22. Mai 2007. Bis jetzt, wo ich dies schreibe, haben 6.876 Bundesbürger, einschließlich mir selbst unterzeichnet. Das reicht aber bei weitem nicht, notwendig sind 50.000 Unterschriften.
Ich bitte Euch, die Ihr mein Blog lest oder meinen Podcast hört, unterstützt diese Petition, folgt dem Link, und tragt Euch als Mitzeichner ein. Ob es gelingt bis zum 16. Juli die erforderlichen Stimmen zusammenzubekommen, ist fraglich. Aber lasst es uns wenigstens vesuchen! Es wäre hilfreich, wenn sich mindestens eines der Alphatiere der Blogosphäre dieser Sache vehement annehmen würde. Nur einen Link zu setzen, ist nicht genug. Ich bin immer noch der Meinung, richtige Macht hätten wir Blogger erst, wenn wir Gesetze durchsetzen oder verhindern können. Hier wäre die Gelegenheit, es zu beweisen. Ich kann diese Sache aus zwei Gründen nicht selbst in die Hand nehmen:
1. Mein Weblog Nordlichter hat nur 20 Besucher am Tag.
2. Ich bin seit Donnerstag mit der Strahlentherapie beschäftigt.
Wer solcher Art Therapie nach einer Krebsoperation hinter sich hatte, der weiß, man kommt in der Zeit kaum zu etwas anderem. Am Donnerstag wurde es nun ernst, ich fuhr mit dem Taxi nach Greifswald zur Strahlentherapie. Statt der Stühle wie vor zwei Jahren war der Warteraum jetzt mit hässlichen blauen Klubsesseln vollgestellt. Bequemer saß ich darin nicht, ich kam mir noch verlorener vor. Die Dame an der Annahme konnte sich an mich erinnern. Im Gegensatz zur ersten Bestrahlungstherapie musste ich mich nun oberhalb des Nabels entblößen, bevor ich auf die Pritsche kletterte. Diesmal lag ich auf dem Rücken die Arme über dem Kopf verschränkt. Die Assistentin zerrte das bunte Badetuch mit mir darauf in die richtige Position und verschwand dann hinter der Tür.
Da lag ich nun allein auf meinem Badetuch die Strahlenkanone im Blick. Ich hätte gut jemand gebrauchen können, der meine Hand hielt. Aber es war niemand da. Das Gerät schwebte drohend über mir. Plötzlich rannen Tränen über mein Gesicht, ohne dass ich schluchzen musste, und ohne dass ich es verhindern konnte. Weil ich auf dem Rücken lag und mich nicht bewegen durfte, lief mir das Wasser rechts und links in die Ohren. Johnny Logan sang passenderweise "hold me now, don't cry". Ich konnte trotzdem nicht aufhören meine Ohren zu wässern, obwohl es doch erst die Simulation war und noch nicht die richtige Bestrahlung. Ich musste mir die Seen aus den Horchlöffeln wischen.
Anschließend konnte ich mich wieder anziehen und im Wartesaal platzieren. Ich wurde in die Kabine eins gebeten. Dort diente ein Klappbrett neben der Tür gleichzeitig als Sperre und Sitz. Vor zwei Jahren, als mein Bauch behandelt wurde, brauchte ich in keine Kabine zu gehen. Ich durfte mich direkt am Bestrahlungsgerät entblättern. Weil ich jetzt über ein kleines Stück Flur gehen musste, drapierte ich mein Badetuch wie eine Toga über die Schultern. Die Assistentin erkannte mich wieder. "Frau T., ich hatte Ihnen doch gesagt, ich will sie hier nicht mehr sehen." Ich war ja nicht freiwillig gekommen. Vor zwei Jahren hatte ich auf dem Bauch liegend das Geschütz kam gesehen sondern mehr gehört. Jetzt hatte ich es voll im Blick. Bei der Bestrahlung lag mein Kopf nach links geneigt. So flutete ich mein linkes Ohr.
Die körperliche Verwundung ist die eine Seite die seelische die andere. Auch wenn ich nicht rumjammerte, sah die Assistentin natürlich, was mit mir los war. Ob ich reden wolle? Bei der Strahlentherapie werden täglich dutzende von Patienten durchgeschleust, trotzdem ist man hier keine Nummer. Es ist kein Behandeln nur nach Dienstvorschrift. Während der langen Zeit meiner Erkrankung habe ich mich hier immer gut aufgehoben gefühlt, genauso wie bei den Schwestern in der Intensivstation und der Onkologie im Demminer Kreiskrankenhaus. Was man als Patient sucht, ist genau dies, Hilfe und Verständnis. Aber reden wollte ich dennoch nicht. Ich wäre dann in Tränen zerflossen.
Heute nach der vierten Bestrahlung fragte mich die Assistentin nochmals, wie ich mich fühle. Besser, die ersten beiden Tage waren besonders schlimm. Da kam alles wieder hoch. Dass ich das Gerät sehe, ist für mich eine zusätzliche Pein. Die Assistentin zeigte mir ihr Einfühlungsvermögen. Wann immer ich reden oder zum Wasserfall mutieren wolle, bräuchte ich es nur zu sagen. Ich weiß das, alleine dass es diese Möglichkeit gibt, hilft mir. Ansonsten fangen meine beiden Freundinnen hier, die mich anrufen und besuchen, das meiste ab. Ich bin froh, dass sie mir immer noch beistehen.
In einem Monat habe ich Geburtstag. Das wird dann die dritte bescheidene Feier in steter Folge werden. Bei der ersten wurde ich nach der Darmoperation aus dem Krankenhaus entlassen, bei der zweiten lag ich mit der Chemopumpe um den Hals in der Onkologie, und jetzt erhalte ich meine Strahlendosis als Geschenk. Vielen Dank, Herr Krebs! Ich habe die Nase voll.
Mittwoch, 20. Juni 2007
Schäden
Mittwoch, 20. Juni 2007, Kategorie: 'Krankengeschichten'
Nun habe ich es schriftlich und von Amts wegen bestätigt, ich habe einen gewaltigen Schaden. Keinen vollen zum Glück, aber ich bin zu 90% demoliert. Über diese Schwere war ich dann doch schockiert, denn ich hatte mit einem Behinderungsgrad von maximal 75% gerechnet. Zumindest ist mir klar, dass ich vorerst kaum wieder volle 8 Stunden werde arbeiten können. Auch wenn die Gutachterin vom Amt für Arbeit beliebte per Ferndiagnose etwas anderes zu entscheiden. Für meine Schwerbeschädigung berücksichtigte das Neubrandenburger Versorgungsamt die Lymphödeme in beiden Beinen, das fehlende Stück Dickdarm sowie die Dickdarmerkrankung.
Keine Rolle hingegen spielte mein Pavianhintern, und so erhielt ich kein Merkzeichen RF. Es ist offensichtlich zumutbar für mich mit vollen Windelhosen z.B. im Konzert zu sitzen. Die GEZ kann sich auch weiterhin an meinen Beiträgen erfreuen. Nach fünf Jahren wird von Amts wegen geprüft, ob ich meinen Schwerbeschädigtenausweis behalten darf. Das könnte sich die Behörde eigentlich sparen. Die Chance, dass mir ein neuer Dickdarm nachwächst oder Lymphknoten im Bauch, ist relativ gering. Unbeachtet ist noch meine Brustkrebserkrankung, der Grad der Behinderung wird sich dadurch kaum erhöhen.
Die Sozialarbeiterin in der Greifswalder Frauenklinik hatte mir versprochen die Unterlagen zum Versorgungsamt zu schicken. Sie war sehr empört, als sie hörte, im Demminer Kreiskrankenhaus sei mir nur das Formular in die Hand gedrückt worden. So was ginge aber nicht! Doch das ging damals, es gingen noch ganz andere Sachen. Ich musste gezielt nach der Reha fragen, erfuhr dann, dass mich die Sozialarbeiterin nicht in ihrem Karteikasten vermerkt hätte, und wurde von ihr zum Rententräger geschickt. Dort sollte ich mir das Antragsformular holen. Für mich war der Gang dahin wegen meiner Schwäche eine große Anstrengung. In Greifswald hatte die Sozialarbeiterin die entsprechenden Papiere parat, füllte sie mit mir aus und sandte sie weiter. Ich habe auch durch Zufall im Internet nach der Rückverlegung erfahren, dass sich hier im Speisesaal des Kreiskrankenhauses eine Stoma-Selbsthilfegruppe trifft. Seitdem habe ich vergessen, dass es im Roten Krankenhaus jemand gibt, der für Sozialarbeit zuständig ist. Wenn ich ein Problem habe, wo ich meine, die Sozialarbeiterin könne helfen, rufe ich immer in Greifswald an nie in Demmin.
Aber meinen Frauenarzt hatte ich wieder aufgesucht, um ihn zu fragen, ob die Delle auf der Brust so sein muss. Er meinte, das wäre in Ordnung und wahrscheinlich würde die Narbe noch weiter einfallen. Wenn man so wenig Vorbau hätte wie ich, würde sich eine Einbuchtung nicht vermeiden lassen. Vielleicht werde ich nach dem Ende der Strahlentherapie ausgestopft wie eine Weihnachtsgans. Mein Arzt erinnerte mich daran, dass ich während der Bestrahlung einmal die Woche zum Blutabnehmen in der Praxis erscheinen muss. Ich könne wieder hoffnungsfroh in die Zukunft schauen, stellte er fest. Dann wollte er wissen, wie ich seelisch drauf wäre.
Der erste Schrecken ist vorüber. Weil ich jetzt weiß, was mich erwartet und was nicht, geht es mir wieder besser. Nachdem ich alle Pflanzen weggegeben hatte, bin ich nun wieder dabei meinen Balkon zu begrünen. Ich habe es auch geschafft letzte Woche meine Arbeitskollegen zu besuchen. Ein fröhliches Treffen war es allerdings nicht. Doppelkrebs ist auch keine lustige Angelegenheit. Ich berichtete von meinen Anstrengungen, mit den Folgen der Erkrankung zu überleben.
Das Dasein ist für mich sehr mühsam geworden seit der Diagnose Mastdarmkrebs vor zwei Jahren. Ich leide aber nicht mehr am Krebs sondern an den Folgen der Therapie, den vier Operationen, der Bestrahlung, den beiden Chemotherapien. Die zweite Bestrahlung habe ich noch vor mir. Die größten Probleme bereitet mir nach wie vor meine Rückseite mit den heimtückischen durch nichts zu stoppenden Durchfällen. Die Beine sind durch Lymphdrainage und Kompressionsstrümpfe abgeschwollen, aber die Füße schmerzen noch immer. Ich hatte dieses Druckgefühl ja schon mal mit einem Schraubstock umschrieben. Zusätzlich habe ich kein Gefühl in den Füßen, weiß also nie, ob sie gerade kalt oder warm sind.
Obwohl mir das Laufen immer noch schwerfällt, absolviere ich täglich meinen Spaziergang. Zweimal pro Woche sind dann etwas längere von ungefähr 1 ½ Stunden Dauer darunter. Meine Arbeitskollegen wunderten sich, wie man sich bei diesen Beschwerden, immer wieder zum Gehen motivieren könne. Meine Antwort, fürchte ich, fiel recht brutal aus. „Entweder ich will leben oder nicht.“
Einer meiner Kollegen wollte wissen, ob ich daran gedacht hätte aufzugeben. Nach der Stanzbiopsie in Greifswald so mindestens eintausendmal. Ich hatte mich gefragt, ob sich die ganze Marter gelohnt hätte, die Ängste, die Schmerzen, die Übelkeit, die Einschränkungen. Bis dahin hatte ich immer gehofft, bald in ein halbwegs normales Leben zurückkehren zu können. Mit Brustkrebs hatte ich überhaupt nicht gerechnet. In meiner Sippe gab es keinen einzigen Fall. Es riss mir einfach die Beine weg. Jeden Morgen, nachdem ich die Augen aufschlug, dachte ich für einen Moment daran, liegenzubleiben, mich dem Krebs zu ergeben. Dennoch habe ich mich jedes Mal wieder hochgequält und mir diese Folterstrümpfe über die Beine gestreift.
Aber es gibt auch kleine Fortschritte. An den Händen hat sich das Taubheitsgefühl von den Handflächen in die Fingerspitzen zurückgezogen. Es kribbelt auch nur noch dort. Gleichzietig hat sich meine Geschicklichkeit enorm verbessert. Ich kann mir wieder Stecker in die Ohren stöpseln. Vielleicht bin ich bald in der Lage all die Comics, die ich seit der ersten Operation im Kopf mit mir herumtrage, aufs Papier zu bannen.
Meine Physiotherapeutin hatte mir bei der letzten Sitzung verkündet, ich wäre wieder was zum Anfassen. Der Zeiger der Waage erreichte die 60-kg-Marke. Das ist mein altes Kampfgewicht, damit fühle ich mich am wohlsten. Ich habe wieder richtige Arme und, was ich hinten mit mir herumtrage, verdient die Bezeichnung Gesäß. Auf alle Fälle ist es gut für mich, kein Untergewicht zu haben, denn wie ich die 33 Bestrahlungen vertragen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht verhagelt es mir den Appetit. Die Assistentin hat mir die roten Zielkreuze für die Strahlenkanone schon auf den Oberkörper gezeichnet. Der Stift, den sie verwendete war aber nicht wasserfest. So war mein weißer Sport-BH dann auch gleich mitmarkiert.
Es blieb nicht der einzige Farbschaden der Woche. Extra für die Strahlentherapie hatte ich mir ein neues kunterbuntes Badetuch zugelegt. Vor zwei Jahren hatte ich eins in freundlichem anthrazit, das aber inzwischen in den Status eines normalen Duschhandtuchs aufgestiegen ist. Das neue wollte ich vor dem ersten Einsatz waschen. Weil ich nur weiße Wäsche hatte, warf ich das kunterbunte Badetuch kurzentschlossen hinzu. Jetzt weiß ich auch wieder, warum man weiße und farbige Wäsche hübsch separiert. Denn obwohl das Design Herbstlaub nicht danach aussah, verfärbte es meine restliche Wäsche. Ausgerechnet die lindgrünen Blätter erwiesen sich als nicht farbecht. Na gut, ich mag ja sowieso nichts Weißes, und der weiße Sport-BH sieht mit hellgrüner Umrandung gleich viel besser aus.
Keine Rolle hingegen spielte mein Pavianhintern, und so erhielt ich kein Merkzeichen RF. Es ist offensichtlich zumutbar für mich mit vollen Windelhosen z.B. im Konzert zu sitzen. Die GEZ kann sich auch weiterhin an meinen Beiträgen erfreuen. Nach fünf Jahren wird von Amts wegen geprüft, ob ich meinen Schwerbeschädigtenausweis behalten darf. Das könnte sich die Behörde eigentlich sparen. Die Chance, dass mir ein neuer Dickdarm nachwächst oder Lymphknoten im Bauch, ist relativ gering. Unbeachtet ist noch meine Brustkrebserkrankung, der Grad der Behinderung wird sich dadurch kaum erhöhen.
Die Sozialarbeiterin in der Greifswalder Frauenklinik hatte mir versprochen die Unterlagen zum Versorgungsamt zu schicken. Sie war sehr empört, als sie hörte, im Demminer Kreiskrankenhaus sei mir nur das Formular in die Hand gedrückt worden. So was ginge aber nicht! Doch das ging damals, es gingen noch ganz andere Sachen. Ich musste gezielt nach der Reha fragen, erfuhr dann, dass mich die Sozialarbeiterin nicht in ihrem Karteikasten vermerkt hätte, und wurde von ihr zum Rententräger geschickt. Dort sollte ich mir das Antragsformular holen. Für mich war der Gang dahin wegen meiner Schwäche eine große Anstrengung. In Greifswald hatte die Sozialarbeiterin die entsprechenden Papiere parat, füllte sie mit mir aus und sandte sie weiter. Ich habe auch durch Zufall im Internet nach der Rückverlegung erfahren, dass sich hier im Speisesaal des Kreiskrankenhauses eine Stoma-Selbsthilfegruppe trifft. Seitdem habe ich vergessen, dass es im Roten Krankenhaus jemand gibt, der für Sozialarbeit zuständig ist. Wenn ich ein Problem habe, wo ich meine, die Sozialarbeiterin könne helfen, rufe ich immer in Greifswald an nie in Demmin.
Aber meinen Frauenarzt hatte ich wieder aufgesucht, um ihn zu fragen, ob die Delle auf der Brust so sein muss. Er meinte, das wäre in Ordnung und wahrscheinlich würde die Narbe noch weiter einfallen. Wenn man so wenig Vorbau hätte wie ich, würde sich eine Einbuchtung nicht vermeiden lassen. Vielleicht werde ich nach dem Ende der Strahlentherapie ausgestopft wie eine Weihnachtsgans. Mein Arzt erinnerte mich daran, dass ich während der Bestrahlung einmal die Woche zum Blutabnehmen in der Praxis erscheinen muss. Ich könne wieder hoffnungsfroh in die Zukunft schauen, stellte er fest. Dann wollte er wissen, wie ich seelisch drauf wäre.
Der erste Schrecken ist vorüber. Weil ich jetzt weiß, was mich erwartet und was nicht, geht es mir wieder besser. Nachdem ich alle Pflanzen weggegeben hatte, bin ich nun wieder dabei meinen Balkon zu begrünen. Ich habe es auch geschafft letzte Woche meine Arbeitskollegen zu besuchen. Ein fröhliches Treffen war es allerdings nicht. Doppelkrebs ist auch keine lustige Angelegenheit. Ich berichtete von meinen Anstrengungen, mit den Folgen der Erkrankung zu überleben.
Das Dasein ist für mich sehr mühsam geworden seit der Diagnose Mastdarmkrebs vor zwei Jahren. Ich leide aber nicht mehr am Krebs sondern an den Folgen der Therapie, den vier Operationen, der Bestrahlung, den beiden Chemotherapien. Die zweite Bestrahlung habe ich noch vor mir. Die größten Probleme bereitet mir nach wie vor meine Rückseite mit den heimtückischen durch nichts zu stoppenden Durchfällen. Die Beine sind durch Lymphdrainage und Kompressionsstrümpfe abgeschwollen, aber die Füße schmerzen noch immer. Ich hatte dieses Druckgefühl ja schon mal mit einem Schraubstock umschrieben. Zusätzlich habe ich kein Gefühl in den Füßen, weiß also nie, ob sie gerade kalt oder warm sind.
Obwohl mir das Laufen immer noch schwerfällt, absolviere ich täglich meinen Spaziergang. Zweimal pro Woche sind dann etwas längere von ungefähr 1 ½ Stunden Dauer darunter. Meine Arbeitskollegen wunderten sich, wie man sich bei diesen Beschwerden, immer wieder zum Gehen motivieren könne. Meine Antwort, fürchte ich, fiel recht brutal aus. „Entweder ich will leben oder nicht.“
Einer meiner Kollegen wollte wissen, ob ich daran gedacht hätte aufzugeben. Nach der Stanzbiopsie in Greifswald so mindestens eintausendmal. Ich hatte mich gefragt, ob sich die ganze Marter gelohnt hätte, die Ängste, die Schmerzen, die Übelkeit, die Einschränkungen. Bis dahin hatte ich immer gehofft, bald in ein halbwegs normales Leben zurückkehren zu können. Mit Brustkrebs hatte ich überhaupt nicht gerechnet. In meiner Sippe gab es keinen einzigen Fall. Es riss mir einfach die Beine weg. Jeden Morgen, nachdem ich die Augen aufschlug, dachte ich für einen Moment daran, liegenzubleiben, mich dem Krebs zu ergeben. Dennoch habe ich mich jedes Mal wieder hochgequält und mir diese Folterstrümpfe über die Beine gestreift.
Aber es gibt auch kleine Fortschritte. An den Händen hat sich das Taubheitsgefühl von den Handflächen in die Fingerspitzen zurückgezogen. Es kribbelt auch nur noch dort. Gleichzietig hat sich meine Geschicklichkeit enorm verbessert. Ich kann mir wieder Stecker in die Ohren stöpseln. Vielleicht bin ich bald in der Lage all die Comics, die ich seit der ersten Operation im Kopf mit mir herumtrage, aufs Papier zu bannen.
Meine Physiotherapeutin hatte mir bei der letzten Sitzung verkündet, ich wäre wieder was zum Anfassen. Der Zeiger der Waage erreichte die 60-kg-Marke. Das ist mein altes Kampfgewicht, damit fühle ich mich am wohlsten. Ich habe wieder richtige Arme und, was ich hinten mit mir herumtrage, verdient die Bezeichnung Gesäß. Auf alle Fälle ist es gut für mich, kein Untergewicht zu haben, denn wie ich die 33 Bestrahlungen vertragen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht verhagelt es mir den Appetit. Die Assistentin hat mir die roten Zielkreuze für die Strahlenkanone schon auf den Oberkörper gezeichnet. Der Stift, den sie verwendete war aber nicht wasserfest. So war mein weißer Sport-BH dann auch gleich mitmarkiert.
Es blieb nicht der einzige Farbschaden der Woche. Extra für die Strahlentherapie hatte ich mir ein neues kunterbuntes Badetuch zugelegt. Vor zwei Jahren hatte ich eins in freundlichem anthrazit, das aber inzwischen in den Status eines normalen Duschhandtuchs aufgestiegen ist. Das neue wollte ich vor dem ersten Einsatz waschen. Weil ich nur weiße Wäsche hatte, warf ich das kunterbunte Badetuch kurzentschlossen hinzu. Jetzt weiß ich auch wieder, warum man weiße und farbige Wäsche hübsch separiert. Denn obwohl das Design Herbstlaub nicht danach aussah, verfärbte es meine restliche Wäsche. Ausgerechnet die lindgrünen Blätter erwiesen sich als nicht farbecht. Na gut, ich mag ja sowieso nichts Weißes, und der weiße Sport-BH sieht mit hellgrüner Umrandung gleich viel besser aus.
Montag, 11. Juni 2007
Allein zu Haus
Montag, 11. Juni 2007, Kategorie: 'Krankengeschichten'
Die letzte Visite am Sonntag hatte ausgerechnet die Ärztin, die sich durch besonderes Zartgefühl mir gegenüber ausgezeichnet hatte. Ich will wegen meiner Erkrankung nicht bedauert werden. Aber ein Mindestmaß an Einfühlungsvermögen und Respekt kann ich wohl erwarten. Mir so nebenbei zu sagen ich hätte Brustkrebs, mich dann anschließend ½ Stunde allein auf dem Flur warten zu lassen, und das bei meiner Vorgeschichte, zähle ich nicht dazu. Manche Mediziner sollte man lieber nicht auf Patienten loslassen. Als Insektenkundler wären sie weit besser eingesetzt.
Frau Doktor trug wieder ein bauchfreies Shirt unter dem weißen Kittel und entsprechend cool fiel die Visite aus. In der Krebskonferenz in einer Woche würde die Therapie für mich festgelegt werden. Ich sollte nach meiner Entlassung meinen Frauenarzt aufsuchen und mich von ihm unter anderem zur Knochenszintigraphie nach Greifswald überweisen lassen. Es war mir unverständlich, wieso das nicht in der Zeit, in der ich im Krankenhaus lag, erledigt werden konnte. Die schnarchende alte Dame war am Entlassungstag zur Nuklearmedizin gefahren worden. Für mich bedeutete nochmals von Demmin nach Greifswald gondeln zu müssen nur neuerlichen Stress und natürlich auch extra Kosten. Außerdem in der folgenden Woche war ein Feiertag, wohlgemerkt. Für Frau Doktor war das kein Grund mich auch nur einen Tag länger im Krankenhaus zu behalten. Meine persönliche Situation interessierte nicht die Bohne. Diese Ärztin und ich werden nie ein dynamisches Duo bilden.
Ich wurde am Sonntag nach dem Mittag entlassen. Dieses Mal konnte mich niemand von meiner Berliner Großfamilie abholen, ich musste das Taxi bestellen. Mein Kühlschrank war leer, aber ich brauchte trotzdem nicht zum Tante-Emma-Laden pilgern. Meine Mitpatientinnen, von denen ich mich herzlich verabschiedet hatte, hatten für mich Lebensmittel gesammelt. Sie befürchteten wohl, ich würde bis Montag verhungern, und ließen keine Einwände gelten. Ich musste mir Brötchen, Fischkonserven und Käse einstecken. Bis zum Montagmorgen langte das schon, da war ich dann mit Einkaufen beschäftigt. Meine Arbeitskollegen holten für mich Getränke. Ich kann nach der Operation ja wieder nicht schwer tragen, auch nicht im Rucksack.
Mein Frauenarzt wickelte mich am nächsten Tag aus dem Brustverband. Er meinte, es würde gut aussehen. Die Brustwarzen wären auf gleicher Höhe. Ich durfte für alle möglichen Tests eine Menge Blut spenden. Den Wickel erhielt ich nicht zurück, sondern sollte mir einen Sport-BH zulegen. Mit einem ist es natürlich nicht getan, wenn man das Ding Tag und Nacht tragen soll. Irgendwann müsste ich ihn ja auch mal waschen. Ob ausstauben allein für die Hygiene reicht, ist zu bezweifeln. Gar nicht so einfach in Demmin einen passenden Sport-BH zu erwerben, wenn man ihn benötigt.
Am Montag sollte es laut Werbeprospekte zufällig welche geben. So machte ich mich frohen Mutes auf den Weg in die für mich per pedes erreichbaren Demminer Supermärkte. Sport-BHs gab es nur in den Prospekten sonst nirgendwo. Gar nicht super, denn ich musste nun ins Sportgeschäft. Der BH, den ich dort erstand, war meiner schmalen Erwerbsminderungsrente keineswegs angemessen. Gewöhnlich hätte ich für den Preis mehrere Exemplare gekauft. Dass das gute Stück wie angegossen saß, tröstete mich nur wenig. Die ältere Mitpatientin in Greifswald musste für ihr Stützgerüst 220 Euronen bezahlen. Der war nur einfach weiß und keineswegs aus Gold. Wobei noch nicht raus war, ob die Krankenkasse die Kosten des BHs übernehmen wird. Da bin ich dann doch etwas besser weggekommen. Dank meiner Freundinnen und meiner Kusine habe ich inzwischen mehrere Stücke. Vom Material und Tragegefühl gleichauf am besten der Marken-BH aus dem Sportgeschäft und das herabgesetzte Teil vom Discounter. Der eine kostete 50 Euronen der andere 5. Vermutlich hat eine asiatische Arbeiterin beide Stücke für den gleichen mageren Lohn gefertigt. Ich muss die Sport-BHs zwei Monate tragen. Nachts wähle ich die Exemplare, die nicht ganz so eng sitzen.
Seit ich aus dem Krankenhaus zurück bin, gehe ich nicht nur mit BH sondern auch mit einem Sofakissen ins Bett. Natürlich kann ich mir was besseres vorstellen, als morgens ein Kissen im Arm zu halten. Neben einer Chemopumpe zu erwachen ist allerdings weitaus weniger amüsant. Mein rechter Arm schmerzt immer noch. Solange das so ist, bleibt das Sofakissen mein Bettgenosse. Vielleicht sollte ich ein Gesicht draufmalen.
Wie erwartet gelang es der Schwester beim Frauenarzt nicht, einen Termin fürs Szintigramm vor der Krebskonferenz zu ergattern. Wenn Donnerstag Feiertag ist, wird Freitag nicht geröntgt, weder in Greifswald noch in Stralsund oder Neubrandenburg. Weiter weg wollte sie mich dann doch nicht schicken. Ich fuhr um die Mittagszeit per Taxi zur Praxis nach Greifswald. Dort spritzte mir die Schwester ein radioaktives Kontrastmittel in den Arm, und dann hieß es drei Stunden warten, bis sich die Substanz in den Knochen angereichert hatte. Um draußen herumzumarschieren lag die Praxis zu weit abgelegen. Also blieb ich dort. Im Flur, der den Warteraum bildete, lagen genug Zeitschriften aus, sogar PC-Magazine. Der Strahlenmediziner hatte vermutlich einen Mac. Die Aufnahme mit der Gammakamera dauerte dann keine 30 Minuten. Dazu musste ich mich auf den Rücken legen. Meine Füße waren mit einem Band aneinander gefesselt. Ich sollte mich nicht bewegen. Aber immer dann krabbelt es an der Nase, am Bauch juckt es, und im kleinen Zeh beginnt ein Krampf. Die Kamera schwebte millimeterweise über mich hinweg. Mittlerweile war es nach 17.00 Uhr. Der Taxifahrer kam gerade rechtzeitig, bevor die Schwester um 18.00 Uhr die Praxis abschloss.
Das nächste Mal schickte mich mein Frauenarzt nach Greifswald zur Strahlenmedizin. Vorher hatte er mir freudestrahlend verkündet, der Brustkrebs hätte keine Metastasen gebildet. Ich bräuchte also nur die Strahlentherapie hinter mich zu bringen, keine erneute Operation und keine Chemo. Aber der Bestrahlung wird sich eine Antihormontherapie anschließen. Ohne Nebenwirkungen ist die freilich nicht. Die Zahl der Nachsorgeuntersuchungen wird auch steigen. Meine Ärzte werden sich da wohl einigen müssen.
Die Medizinerin im Strahlenzentrum, die das Vorgespräch mit mir führte, legte schon gleichmal den Termin für die Nachsorge von Darm- und Brustkrebs zusammen. Ich werde 33 Bestrahlungen erhalten, genausoviele wie damals nach der Darm-OP. Es wird nur die rechte Seite bestrahlt werden und nicht der gesamte Brustkorb. Wir plauschten noch ein wenig über mein rückwärtiges Problem. Sie sagte mir, an meiner Stelle würde sie sich dazu noch eine weitere Meinung einholen. Die Ärztin erzählte mir von einer Freundin, die ein Colostoma hätte und damit gut zurechtkäme. Bis die Bestrahlung beginnt, bleibt mir jetzt noch eine Woche Zeit. Die Operationsnarbe war der Ärztin noch zu frisch. Die sollte erst gut abheilen.
Die Schwester hatte mich, wie schon bei unserer ersten Begegnung vor zwei Jahren, aufgemuntert. Ihre Mutter berichtete sie mir, hätte auch Doppelkrebs gehabt, erst Brust- und später Darmkrebs. Trotzdem wäre sie 83 Jahre alt geworden. Ich sollte das mal wohlwollend in Erwägung ziehen.
 7,7 MB
7,7 MB
Frau Doktor trug wieder ein bauchfreies Shirt unter dem weißen Kittel und entsprechend cool fiel die Visite aus. In der Krebskonferenz in einer Woche würde die Therapie für mich festgelegt werden. Ich sollte nach meiner Entlassung meinen Frauenarzt aufsuchen und mich von ihm unter anderem zur Knochenszintigraphie nach Greifswald überweisen lassen. Es war mir unverständlich, wieso das nicht in der Zeit, in der ich im Krankenhaus lag, erledigt werden konnte. Die schnarchende alte Dame war am Entlassungstag zur Nuklearmedizin gefahren worden. Für mich bedeutete nochmals von Demmin nach Greifswald gondeln zu müssen nur neuerlichen Stress und natürlich auch extra Kosten. Außerdem in der folgenden Woche war ein Feiertag, wohlgemerkt. Für Frau Doktor war das kein Grund mich auch nur einen Tag länger im Krankenhaus zu behalten. Meine persönliche Situation interessierte nicht die Bohne. Diese Ärztin und ich werden nie ein dynamisches Duo bilden.
Ich wurde am Sonntag nach dem Mittag entlassen. Dieses Mal konnte mich niemand von meiner Berliner Großfamilie abholen, ich musste das Taxi bestellen. Mein Kühlschrank war leer, aber ich brauchte trotzdem nicht zum Tante-Emma-Laden pilgern. Meine Mitpatientinnen, von denen ich mich herzlich verabschiedet hatte, hatten für mich Lebensmittel gesammelt. Sie befürchteten wohl, ich würde bis Montag verhungern, und ließen keine Einwände gelten. Ich musste mir Brötchen, Fischkonserven und Käse einstecken. Bis zum Montagmorgen langte das schon, da war ich dann mit Einkaufen beschäftigt. Meine Arbeitskollegen holten für mich Getränke. Ich kann nach der Operation ja wieder nicht schwer tragen, auch nicht im Rucksack.
Mein Frauenarzt wickelte mich am nächsten Tag aus dem Brustverband. Er meinte, es würde gut aussehen. Die Brustwarzen wären auf gleicher Höhe. Ich durfte für alle möglichen Tests eine Menge Blut spenden. Den Wickel erhielt ich nicht zurück, sondern sollte mir einen Sport-BH zulegen. Mit einem ist es natürlich nicht getan, wenn man das Ding Tag und Nacht tragen soll. Irgendwann müsste ich ihn ja auch mal waschen. Ob ausstauben allein für die Hygiene reicht, ist zu bezweifeln. Gar nicht so einfach in Demmin einen passenden Sport-BH zu erwerben, wenn man ihn benötigt.
Am Montag sollte es laut Werbeprospekte zufällig welche geben. So machte ich mich frohen Mutes auf den Weg in die für mich per pedes erreichbaren Demminer Supermärkte. Sport-BHs gab es nur in den Prospekten sonst nirgendwo. Gar nicht super, denn ich musste nun ins Sportgeschäft. Der BH, den ich dort erstand, war meiner schmalen Erwerbsminderungsrente keineswegs angemessen. Gewöhnlich hätte ich für den Preis mehrere Exemplare gekauft. Dass das gute Stück wie angegossen saß, tröstete mich nur wenig. Die ältere Mitpatientin in Greifswald musste für ihr Stützgerüst 220 Euronen bezahlen. Der war nur einfach weiß und keineswegs aus Gold. Wobei noch nicht raus war, ob die Krankenkasse die Kosten des BHs übernehmen wird. Da bin ich dann doch etwas besser weggekommen. Dank meiner Freundinnen und meiner Kusine habe ich inzwischen mehrere Stücke. Vom Material und Tragegefühl gleichauf am besten der Marken-BH aus dem Sportgeschäft und das herabgesetzte Teil vom Discounter. Der eine kostete 50 Euronen der andere 5. Vermutlich hat eine asiatische Arbeiterin beide Stücke für den gleichen mageren Lohn gefertigt. Ich muss die Sport-BHs zwei Monate tragen. Nachts wähle ich die Exemplare, die nicht ganz so eng sitzen.
Seit ich aus dem Krankenhaus zurück bin, gehe ich nicht nur mit BH sondern auch mit einem Sofakissen ins Bett. Natürlich kann ich mir was besseres vorstellen, als morgens ein Kissen im Arm zu halten. Neben einer Chemopumpe zu erwachen ist allerdings weitaus weniger amüsant. Mein rechter Arm schmerzt immer noch. Solange das so ist, bleibt das Sofakissen mein Bettgenosse. Vielleicht sollte ich ein Gesicht draufmalen.
Wie erwartet gelang es der Schwester beim Frauenarzt nicht, einen Termin fürs Szintigramm vor der Krebskonferenz zu ergattern. Wenn Donnerstag Feiertag ist, wird Freitag nicht geröntgt, weder in Greifswald noch in Stralsund oder Neubrandenburg. Weiter weg wollte sie mich dann doch nicht schicken. Ich fuhr um die Mittagszeit per Taxi zur Praxis nach Greifswald. Dort spritzte mir die Schwester ein radioaktives Kontrastmittel in den Arm, und dann hieß es drei Stunden warten, bis sich die Substanz in den Knochen angereichert hatte. Um draußen herumzumarschieren lag die Praxis zu weit abgelegen. Also blieb ich dort. Im Flur, der den Warteraum bildete, lagen genug Zeitschriften aus, sogar PC-Magazine. Der Strahlenmediziner hatte vermutlich einen Mac. Die Aufnahme mit der Gammakamera dauerte dann keine 30 Minuten. Dazu musste ich mich auf den Rücken legen. Meine Füße waren mit einem Band aneinander gefesselt. Ich sollte mich nicht bewegen. Aber immer dann krabbelt es an der Nase, am Bauch juckt es, und im kleinen Zeh beginnt ein Krampf. Die Kamera schwebte millimeterweise über mich hinweg. Mittlerweile war es nach 17.00 Uhr. Der Taxifahrer kam gerade rechtzeitig, bevor die Schwester um 18.00 Uhr die Praxis abschloss.
Das nächste Mal schickte mich mein Frauenarzt nach Greifswald zur Strahlenmedizin. Vorher hatte er mir freudestrahlend verkündet, der Brustkrebs hätte keine Metastasen gebildet. Ich bräuchte also nur die Strahlentherapie hinter mich zu bringen, keine erneute Operation und keine Chemo. Aber der Bestrahlung wird sich eine Antihormontherapie anschließen. Ohne Nebenwirkungen ist die freilich nicht. Die Zahl der Nachsorgeuntersuchungen wird auch steigen. Meine Ärzte werden sich da wohl einigen müssen.
Die Medizinerin im Strahlenzentrum, die das Vorgespräch mit mir führte, legte schon gleichmal den Termin für die Nachsorge von Darm- und Brustkrebs zusammen. Ich werde 33 Bestrahlungen erhalten, genausoviele wie damals nach der Darm-OP. Es wird nur die rechte Seite bestrahlt werden und nicht der gesamte Brustkorb. Wir plauschten noch ein wenig über mein rückwärtiges Problem. Sie sagte mir, an meiner Stelle würde sie sich dazu noch eine weitere Meinung einholen. Die Ärztin erzählte mir von einer Freundin, die ein Colostoma hätte und damit gut zurechtkäme. Bis die Bestrahlung beginnt, bleibt mir jetzt noch eine Woche Zeit. Die Operationsnarbe war der Ärztin noch zu frisch. Die sollte erst gut abheilen.
Die Schwester hatte mich, wie schon bei unserer ersten Begegnung vor zwei Jahren, aufgemuntert. Ihre Mutter berichtete sie mir, hätte auch Doppelkrebs gehabt, erst Brust- und später Darmkrebs. Trotzdem wäre sie 83 Jahre alt geworden. Ich sollte das mal wohlwollend in Erwägung ziehen.
Montag, 14. Mai 2007
Nachwehen
Montag, 14. Mai 2007, Kategorie: 'Krankengeschichten'
In der Nacht konnte ich immerhin wieder trinken. So blieb die Option bei der Visite, mich an den Tropf zu hängen, auch nur eine Drohung. Den ersten Tag nach der OP döste ich im Bett still vor mich hin, solange mir eine meiner zwei Mitpatientinnen dazu Gelegenheit gab. Die ältere Dame, mit beträchtlichem Busen und Leibumfang, hatte genau den richtigen Resonanzkörper für martialische Schnarchkonzerte. Ich konnte dagegen nur zaghaft hallo, hallo piepsend aufbegehren. Wobei die Kettensäge kurz verstummte, um dann mit noch größerer Lautstärke ihr Tag- und Nachtwerk zu verrichten. Niemand bedauerte diese Ruhestörung mehr als die alte Dame selber. So konnten wir anderen beiden ihr zumindest nicht böse sein.
Die zweite Patientin lag im Bett neben mir und war in meinem Alter. Nachdem ihre rechte Brust wieder aufgebaut worden war, hatte sich zwei Abszesse gebildet. Der kleinere hatte die Größe einer Rosine. In den größeren konnte man eine Tomate hineinstecken. Das behauptete ihr Vater, der sie verbunden hatte, bevor sie ins Krankenhaus fuhr. Die Wunde sah zumindest unschön aus. Das letzte Mal war meine Bettnachbarin zu Ostern im Krankenhaus gewesen. Sie hatte entsprechend die Nase voll. Sie meinte, sie hätte auf den Wiederaufbau ihrer rechten Brust verzichtet, falls sie vorher geahnt hätte, was auf sie zukommt. Nun, hinterher ist man immer schlauer.
Meiner Bettnachbarin wurde unter Narkose ein Vakuumverband angelegt. Dabei wird ein Stück schwarzer Schaumstoff in die Wunde eingepasst und mit einem Folienverband befestigt. Diese Folie schließt die Wunde luftdicht ab. Ein an eine Pumpe angeschlossenes Absaugsystem komplementiert das ganze. Das Gerät musste meine Bettnachbarin wie ein Kofferradio mit sich herumtragen. Es gab ab und zu seltsam schmatzende Geräusche von sich. Mit der Pumpe wird das Wundsekret abgesaugt und gefiltert. Die Brust meiner Nachbarin ähnelte in diesem Folienverband den eingeschweißten Waren an der Wursttheke im Supermarkt.
Meine Operation war brusterhaltend verlaufen und mein Oberkörper nicht in Folie verpackt worden. Stattdessen hatte man mich wie eine ägyptische Mumie in Binden eingewickelt. Weiße Papierstreifen klebten unter dem Verband auf der rechten Brustwarze und dem Schnitt in der Achselhöhle. Sie glichen den Klebestreifen, die ich früher für technische Zeichnungen verwendet hatte. Es gibt doch wirklich äußerst merkwürdige Verbandmaterialien! Der Oberarzt begutachtete während der Visite sein Werk und war sehr zufrieden. Es würde gut aussehen. Na, das hoffte ich doch stark.
Während der sieben Tage in der Frauenklinik brauchte ich die aparten Thrombosestrümpfe nicht überstreifen. Ich hatte diesmal meine eigenen Socken mit. Um die abendliche Spritze kam ich nicht herum. Ich ließ mich in den Bauch piksen. Das hätte ich auch bei meinen früheren Aufenthalten im Krankenhaus getan, falls mich jemand bezüglich der Lymphödemen gewarnt hätte. Aber das hatte niemand getan. In den Beinen habe ich inzwischen welche, und der rechte Arm ist nach der OP gefährdet. Mir darf nur noch links Blut abgezapft werden. An einem Abend gab mir die Schwester keine Spritze. Die Anzahl der Blutplättchen und weißen Blutkörperchen wären so gering. Sag ich doch, ich bekomme laufende Meter blaue Flecke, und mein Immunsystem liegt auch am Boden. Kein Wunder, wenn ich da jeden Krebs aufsammle, der am Wegesrand steht.
Meine Mitpatientinnen fanden meine Krankengeschichte, erst Darmkrebs, dann Lebermetastase, nun Brustkrebs und das alles innerhalb von nur drei Jahren, horrormäßig schlimm. Ich war im Zweifel, wenn ich da an ihre Erkrankungen dachte. Ich glaube nicht, dass man den einen Krebs gegen den anderen aufwiegen kann. Die nette alte Dame hatte inzwischen eine andere ebenso nette alte Dame abgelöst.
Meine beiden Zimmergenossinnen schüttelten sich vor Entsetzen bei dem Gedanken, sie müssten ihre Krebserkrankung allein ertragen. Ihnen stehen ihre Ehemänner zur Seite. Ich hingegen hatte keine Wahl, ich musste und muss da alleine durch. Meinen Mitpatientinnen schmunzelten, als ich ihnen sagte, wenn ich gewusst hätte, was mir blüht, hätte ich mir vor meiner Krankheit selbstverständlich jemanden angelacht. Es wäre schön, stellte die alte Dame fest, wenn man einen Partner hätte, der einem Tee kocht. Oder, ergänzte ich, der einen einfach in den Arm nehmen würde. Die Möglichkeit, in der Zeit der Krankheit jemand kennenzulernen, tendiert doch eher gegen Null. Das einzige, was man zur Genüge sieht, sind Krankenhäuser und andere Nichtgesunde, die mit sich und ihren Beschwerden beschäftigt sind. Davon hat man dann irgendwann genug insbesondere, wenn sich die eigene Krankengeschichte zu einer never ending story entwickelt.
Mit meinen Gebrechen bin ich von vornherein ohne jede Chance gerade auf dem Markt der Eitelkeiten. Wer würde sich von meiner Behinderung nicht abgeschreckt fühlen? Von der noch immer nicht durchgestandenen Krebserkrankung wollen wir erst gar nicht reden. Das Thema habe ich zunächst abgehakt.
Was bin ich nicht? Nicht reich, nicht schön, nicht mehr jung.
Was bin ich? Schwer krank, trotzdem fidel, mit zähem Lebenswillen.
 5,7 MB
5,7 MB
Die zweite Patientin lag im Bett neben mir und war in meinem Alter. Nachdem ihre rechte Brust wieder aufgebaut worden war, hatte sich zwei Abszesse gebildet. Der kleinere hatte die Größe einer Rosine. In den größeren konnte man eine Tomate hineinstecken. Das behauptete ihr Vater, der sie verbunden hatte, bevor sie ins Krankenhaus fuhr. Die Wunde sah zumindest unschön aus. Das letzte Mal war meine Bettnachbarin zu Ostern im Krankenhaus gewesen. Sie hatte entsprechend die Nase voll. Sie meinte, sie hätte auf den Wiederaufbau ihrer rechten Brust verzichtet, falls sie vorher geahnt hätte, was auf sie zukommt. Nun, hinterher ist man immer schlauer.
Meiner Bettnachbarin wurde unter Narkose ein Vakuumverband angelegt. Dabei wird ein Stück schwarzer Schaumstoff in die Wunde eingepasst und mit einem Folienverband befestigt. Diese Folie schließt die Wunde luftdicht ab. Ein an eine Pumpe angeschlossenes Absaugsystem komplementiert das ganze. Das Gerät musste meine Bettnachbarin wie ein Kofferradio mit sich herumtragen. Es gab ab und zu seltsam schmatzende Geräusche von sich. Mit der Pumpe wird das Wundsekret abgesaugt und gefiltert. Die Brust meiner Nachbarin ähnelte in diesem Folienverband den eingeschweißten Waren an der Wursttheke im Supermarkt.
Meine Operation war brusterhaltend verlaufen und mein Oberkörper nicht in Folie verpackt worden. Stattdessen hatte man mich wie eine ägyptische Mumie in Binden eingewickelt. Weiße Papierstreifen klebten unter dem Verband auf der rechten Brustwarze und dem Schnitt in der Achselhöhle. Sie glichen den Klebestreifen, die ich früher für technische Zeichnungen verwendet hatte. Es gibt doch wirklich äußerst merkwürdige Verbandmaterialien! Der Oberarzt begutachtete während der Visite sein Werk und war sehr zufrieden. Es würde gut aussehen. Na, das hoffte ich doch stark.
Während der sieben Tage in der Frauenklinik brauchte ich die aparten Thrombosestrümpfe nicht überstreifen. Ich hatte diesmal meine eigenen Socken mit. Um die abendliche Spritze kam ich nicht herum. Ich ließ mich in den Bauch piksen. Das hätte ich auch bei meinen früheren Aufenthalten im Krankenhaus getan, falls mich jemand bezüglich der Lymphödemen gewarnt hätte. Aber das hatte niemand getan. In den Beinen habe ich inzwischen welche, und der rechte Arm ist nach der OP gefährdet. Mir darf nur noch links Blut abgezapft werden. An einem Abend gab mir die Schwester keine Spritze. Die Anzahl der Blutplättchen und weißen Blutkörperchen wären so gering. Sag ich doch, ich bekomme laufende Meter blaue Flecke, und mein Immunsystem liegt auch am Boden. Kein Wunder, wenn ich da jeden Krebs aufsammle, der am Wegesrand steht.
Meine Mitpatientinnen fanden meine Krankengeschichte, erst Darmkrebs, dann Lebermetastase, nun Brustkrebs und das alles innerhalb von nur drei Jahren, horrormäßig schlimm. Ich war im Zweifel, wenn ich da an ihre Erkrankungen dachte. Ich glaube nicht, dass man den einen Krebs gegen den anderen aufwiegen kann. Die nette alte Dame hatte inzwischen eine andere ebenso nette alte Dame abgelöst.
Meine beiden Zimmergenossinnen schüttelten sich vor Entsetzen bei dem Gedanken, sie müssten ihre Krebserkrankung allein ertragen. Ihnen stehen ihre Ehemänner zur Seite. Ich hingegen hatte keine Wahl, ich musste und muss da alleine durch. Meinen Mitpatientinnen schmunzelten, als ich ihnen sagte, wenn ich gewusst hätte, was mir blüht, hätte ich mir vor meiner Krankheit selbstverständlich jemanden angelacht. Es wäre schön, stellte die alte Dame fest, wenn man einen Partner hätte, der einem Tee kocht. Oder, ergänzte ich, der einen einfach in den Arm nehmen würde. Die Möglichkeit, in der Zeit der Krankheit jemand kennenzulernen, tendiert doch eher gegen Null. Das einzige, was man zur Genüge sieht, sind Krankenhäuser und andere Nichtgesunde, die mit sich und ihren Beschwerden beschäftigt sind. Davon hat man dann irgendwann genug insbesondere, wenn sich die eigene Krankengeschichte zu einer never ending story entwickelt.
Mit meinen Gebrechen bin ich von vornherein ohne jede Chance gerade auf dem Markt der Eitelkeiten. Wer würde sich von meiner Behinderung nicht abgeschreckt fühlen? Von der noch immer nicht durchgestandenen Krebserkrankung wollen wir erst gar nicht reden. Das Thema habe ich zunächst abgehakt.
Was bin ich nicht? Nicht reich, nicht schön, nicht mehr jung.
Was bin ich? Schwer krank, trotzdem fidel, mit zähem Lebenswillen.
Mittwoch, 9. Mai 2007
Die vierte Operation
Mittwoch, 9. Mai 2007, Kategorie: 'Krankengeschichten'
Die Schwester weckte mich gegen 6.00 Uhr, das Frühstück entfiel. Dafür wurde ich mit einer anderen Patientin zur Strahlenmedizin gefahren. Vor zwei Jahren hatte ich im Haus dahinter 33 Bestrahlungen erhalten. Wir sollten in einem Nebenraum warten. Am liebsten hätte ich mich dort auf die Pritsche gelegt und geschlafen. Nach der Anspannung der letzten Tage klappten mir einfach die Lider zu. Die ältere Dame, die mit mir gekommen war, versuchte mir ein Gespräch aufzuzwingen. Sie nervte mich beunruhigt mit Fragen zur Untersuchung, die im Vorfeld sicher die Ärzte beantwortet hatten. Ich war nicht in der Lage zu meiner eigenen Nervosität auch noch die ihre zu ertragen. Entsprechend einsilbig gerieten meine Antworten. Trotzdem erkundigte sich die Frau, ob ich Krankenschwester wäre, ich wüsste so gut Bescheid. Keineswegs, es ist nur schon meine dritte schwere Erkrankung.
Mich rief die Schwester zuerst ins Behandlungszimmer. Die Ärztin, eine kleine zierliche blonde Person, sprach angesichts meiner Vorerkrankung resolut ein Machtwort. Nun wäre es aber endgültig genug! Sie erklärte mir die Untersuchung. Um den zugehörigen Wächterlymphknoten zu ermitteln, wird eine schwach radioaktive Substanz viermal in die Haut über dem tumorverdächtigen Bereich gespritzt. Da ich davon zwei hatte, hieß das in meinem Fall achtmal gestochen zu werden. Es tat höllisch weh, danke der Nachfrage. Die Ärztin war vom Ergebnis begeistert, sie konnte den Sentinel markieren. Die Schwester fotografierte meine Achselhöhle, falls die Kennzeichnung verwischen sollte. Bevor die ältere Patientin mit ihrer Untersuchung fertig war, wurde ich in die Frauenklinik zurückgefahren.
Bis zur Operation war noch über eine Stunde Zeit. Darum wollte ich noch ein wenig vor die Tür gehen, als eine Schwester erschien. Ich sollte mich sogleich umziehen. Nanu, bis jetzt bin ich noch nie vorzeitig zur OP gezerrt worden. Also schlüpfte ich ins rückenfreie Nachthemd und schluckte die LMAA-Pille. Zwei Schwestern fuhren mich im Bett via Fahrstuhl hinunter in den Operationssaal. Ich wechselte vom Bett auf den OP-Tisch. Ein Mann im Kittel und mit Häubchen auf dem Kopf lächelte mich freundlich an und meinte, er wäre der Anästhesist. Die anderen Herrschaften waren bereits vermummt. Rechts montierte jemand ein Brett an den Tisch, auf das ich meinen Arm ablegte. Ein Mann ergriff meine linke Hand und beklopfte den Handrücken wie der Koch ein Steak. Dann setzte er mir endlich die Flexüle. Hinterrücks drückte mir jemand eine Maske sanft aufs Gesicht. Ich brabbelte noch etwas, und dann wurde es dunkel. Vom Aufwachraum weiß ich nichts. Ich kam erst im Zimmer wieder richtig zu mir, und mir war übel.
Bei meinen vorherigen Operationen war mir nie durch die Narkose so abscheulich schlecht gewesen. Wer weiß, was sie mir diesmal für ein Mittel verabreicht hatten. Sobald ich nur den Kopf hob, fiel mir alles aus dem Gesicht, was ich gar nicht im Magen hatte. Ich musste sogar, als ich im Bad auf der Brille hockte, nach der Schwester klingeln, weil mir so übel war. Am besten ließ sich alles im Bett vor sich hindösend ertragen. Rechts lag eine in ein Kopfkissenbezug gehüllte kleine Sprungschanze, die meinen Arm stützte. Aus dem Nachthemd hingen an dieser Seite zwei durchsichtige Kugeln an langen Schläuchen. Sie fingen das Wundsekret auf, und ich musste sie, in einer Plastetüte vereinigt, überallhin mitschleppen. Dabei war Vorsicht geboten, dass ich mir die Dinger nicht aus dem Leib riss.
Aus weiter Ferne hörte ich meine Bettnachbarin, die eine Schwester bat, mich doch schlafen zu lassen. Die aber wollte nicht hören und weckte mich. Sobald ich die Augen aufschlug, musste ich mich schon übergeben. Die Schwester war hinterher damit beschäftigt mir diverse Pappschalen und Papiertücher zu reichen. Das hatte sie nun davon, Strafe musste sein. Beim Spucken hatte ich den Bettbezug und das Nachthemd mit je einem Fleck verziert. Die Schwester sagte mir, sie würde mich umziehen, wenn das Gewürge aufhöre. Dazu kam es dann nicht mehr. Ich wachte am nächsten Morgen mit gelbem Klecks an Nachthemd und Bettbezug auf.
 4,7 MB
4,7 MB
Mich rief die Schwester zuerst ins Behandlungszimmer. Die Ärztin, eine kleine zierliche blonde Person, sprach angesichts meiner Vorerkrankung resolut ein Machtwort. Nun wäre es aber endgültig genug! Sie erklärte mir die Untersuchung. Um den zugehörigen Wächterlymphknoten zu ermitteln, wird eine schwach radioaktive Substanz viermal in die Haut über dem tumorverdächtigen Bereich gespritzt. Da ich davon zwei hatte, hieß das in meinem Fall achtmal gestochen zu werden. Es tat höllisch weh, danke der Nachfrage. Die Ärztin war vom Ergebnis begeistert, sie konnte den Sentinel markieren. Die Schwester fotografierte meine Achselhöhle, falls die Kennzeichnung verwischen sollte. Bevor die ältere Patientin mit ihrer Untersuchung fertig war, wurde ich in die Frauenklinik zurückgefahren.
Bis zur Operation war noch über eine Stunde Zeit. Darum wollte ich noch ein wenig vor die Tür gehen, als eine Schwester erschien. Ich sollte mich sogleich umziehen. Nanu, bis jetzt bin ich noch nie vorzeitig zur OP gezerrt worden. Also schlüpfte ich ins rückenfreie Nachthemd und schluckte die LMAA-Pille. Zwei Schwestern fuhren mich im Bett via Fahrstuhl hinunter in den Operationssaal. Ich wechselte vom Bett auf den OP-Tisch. Ein Mann im Kittel und mit Häubchen auf dem Kopf lächelte mich freundlich an und meinte, er wäre der Anästhesist. Die anderen Herrschaften waren bereits vermummt. Rechts montierte jemand ein Brett an den Tisch, auf das ich meinen Arm ablegte. Ein Mann ergriff meine linke Hand und beklopfte den Handrücken wie der Koch ein Steak. Dann setzte er mir endlich die Flexüle. Hinterrücks drückte mir jemand eine Maske sanft aufs Gesicht. Ich brabbelte noch etwas, und dann wurde es dunkel. Vom Aufwachraum weiß ich nichts. Ich kam erst im Zimmer wieder richtig zu mir, und mir war übel.
Bei meinen vorherigen Operationen war mir nie durch die Narkose so abscheulich schlecht gewesen. Wer weiß, was sie mir diesmal für ein Mittel verabreicht hatten. Sobald ich nur den Kopf hob, fiel mir alles aus dem Gesicht, was ich gar nicht im Magen hatte. Ich musste sogar, als ich im Bad auf der Brille hockte, nach der Schwester klingeln, weil mir so übel war. Am besten ließ sich alles im Bett vor sich hindösend ertragen. Rechts lag eine in ein Kopfkissenbezug gehüllte kleine Sprungschanze, die meinen Arm stützte. Aus dem Nachthemd hingen an dieser Seite zwei durchsichtige Kugeln an langen Schläuchen. Sie fingen das Wundsekret auf, und ich musste sie, in einer Plastetüte vereinigt, überallhin mitschleppen. Dabei war Vorsicht geboten, dass ich mir die Dinger nicht aus dem Leib riss.
Aus weiter Ferne hörte ich meine Bettnachbarin, die eine Schwester bat, mich doch schlafen zu lassen. Die aber wollte nicht hören und weckte mich. Sobald ich die Augen aufschlug, musste ich mich schon übergeben. Die Schwester war hinterher damit beschäftigt mir diverse Pappschalen und Papiertücher zu reichen. Das hatte sie nun davon, Strafe musste sein. Beim Spucken hatte ich den Bettbezug und das Nachthemd mit je einem Fleck verziert. Die Schwester sagte mir, sie würde mich umziehen, wenn das Gewürge aufhöre. Dazu kam es dann nicht mehr. Ich wachte am nächsten Morgen mit gelbem Klecks an Nachthemd und Bettbezug auf.
Montag, 7. Mai 2007
Es ist böse.
Montag, 7. Mai 2007, Kategorie: 'Krankengeschichten'
 Da saß ich also wieder vor einer Patientenaufnahme in der Greifswalder Uniklinik, allerdings später als ursprünglich beordert. Der Taxifahrer fuhr früh um 8.00 Uhr Kinder zur Schule. Eine Stunde danach setzte er mich samt Reisetasche in der Frauenklinik ab. Der dunkelrote Backsteinbau mit dem Tulpenbaum auf dem Hof steht am Ende der Straße, in der sich auch die Chirurgische Klinik mit der Dompassage gegenüber befindet. In der Aufnahme der Chirurgie hatte ein Papier vor dem Betreten des Zimmers gewarnt. Hier war freundlich ein Schild mit der Aufschrift "Bitte Klopfen!" neben der Tür angebracht. Warten musste ich trotzdem.
Da saß ich also wieder vor einer Patientenaufnahme in der Greifswalder Uniklinik, allerdings später als ursprünglich beordert. Der Taxifahrer fuhr früh um 8.00 Uhr Kinder zur Schule. Eine Stunde danach setzte er mich samt Reisetasche in der Frauenklinik ab. Der dunkelrote Backsteinbau mit dem Tulpenbaum auf dem Hof steht am Ende der Straße, in der sich auch die Chirurgische Klinik mit der Dompassage gegenüber befindet. In der Aufnahme der Chirurgie hatte ein Papier vor dem Betreten des Zimmers gewarnt. Hier war freundlich ein Schild mit der Aufschrift "Bitte Klopfen!" neben der Tür angebracht. Warten musste ich trotzdem.Die Mitarbeiterin, die meine Daten in den Computer eingab, klagte, dass sie alles mit der Hand eintippen müsste. Ich bekam wieder dieses merkwürdige papierne Armband umgebunden, auf dem sich neben meinem Namen, Geburtstag und Aufnahmedatum ein Barcode befand. Angeblich wäre das Ding nur zu meinem Besten und um Verwechslungen auf dem OP-Tisch auszuschließen. Mich jedoch gemahnte der Armreif an einen römischen Sklavenmarkt. Eine Telefonkarte ließ ich mir diesmal nicht geben. Die Uniklinik verlangt als Grundgebühr nur dafür, dass ein Telefon betriebsbereit auf dem Nachttisch steht, 1,50 Euro pro Tag. Ein stolzer Preis! Wenn ich im Krankenhaus liege, will ich nur telefonieren und keinen Apparat kaufen. Ich hatte mein Handy im Rucksack.
Nach der Anmeldung folgten die üblichen Checks erst von Studentinnen des letzten Studienjahres dann von der Schwester. Im Krankenhaus gibt es zwar Computer aber die Aufnahme läuft wie im letzten Jahrhundert über Papierformulare. So ist man als Patient gezwungen die gleichen Fragen drei oder viermal zu beantworten. Für mich als Systemadministrator ist das der blanke Irrsinn. Eine Auskunft, die nur die Schwester haben wollte, war, wie ich mich fühlte. Ich antwortete mit einer Gegenfrage. Wie würde sie wohl empfinden mit meiner Vorerkrankung und der Aussicht auch noch Brustkrebs zu haben? Dann fühlte ich mich also schlecht? Ich verneinte, weder noch. Die Schwester war ratlos, sie müsse aber irgendetwas eintragen. Ich konnte ihr nicht helfen. Keine Ahnung, ob und was sie dann wirklich schrieb.
Anschließend musste ich im Flur vor den Untersuchungsräumen ausharren. Hier saßen schon einige Patientinnen, deren Gesichter mir vertraut vorkamen. Mein Personengedächtnis ist ja bekanntlich ziemlich mangelhaft. Es stellte sich heraus, dass alle diese Frauen wie ich Patientinnen der Plauener Rehaklinik gewesen waren. Inzwischen nahte die Mittagszeit und ein Ende der Aufnahmeprozedur kam noch immer nicht in Sicht. Zum Glück für meinen knurrenden Magen hatte ich eine Banane und eine Tafel Schokolade im Rucksack. So konnte ich ein wenig knabbern, bis ich ins Behandlungszimmer gerufen wurde.
Dort befanden sich mehrere Mediziner. Ich musste fröstelnd meinen Oberkörper entblößen. Die Ärztin in bauchfreiem Pulli, die die Sonographie durchführte, erklärte mir recht kalt und unbeteiligt, dass der obere der kleinen Knoten in meiner rechten Brust Krebs wäre. Ich kaute und wäre fast vom Stuhl gefallen. An meiner Reaktion erkannte die Frau Doktor, dass ich völlig ahnungslos war. Mein Gynäkologe hatte mir einige Tage zuvor nach 3 ½ stündiger Wartezeit in seiner Praxis eröffnet, dem Schreiben, das er in der Hand hielt, könne er nicht viel entnehmen. Die Schwester und er hatten mir noch die Daumen gedrückt, dass es kein Krebs wäre. Ich war nach Greifswald zur Klärung des Befundes gefahren nicht wissend, dass der schon feststand.
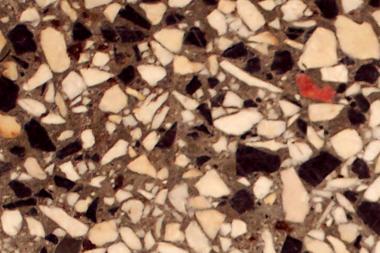
Sie sagten mir also, dass ich Brustkrebs hätte und ließen mich anschließend ½ Stunde allein auf dem Flur vor dem Untersuchungszimmer sitzen. Dort konnte ich meine Schuhspitzen und das Muster des Fußbodens studieren. Eine junge Ärztin und die Frau Doktor mit dem bauchfreien Oberteil passierten den Flur, nicht ohne mir zu sagen, dass es gleich weitergehen würde. Nach der Wartezeit riefen sie mich in den Behandlungsraum nebenan. Dort musste ich meinen Oberkörper abermals entblättern und frierend auf der Pritsche liegen. Die Medizinerin ultrabeschallte meine Brust erneut und telefonierte dann den Oberarzt herbei, der mich am nächsten Tag operieren sollte.
Auch er besah sich meine rechte Seite per Sonographie. Dann markierte der Doktor das Operationsgebiet um die Brustwarze und darüber mit einem Filzstift. Dort würde er am nächsten Tag das Skalpell ansetzen. Er fragte, ob das in Ordnung wäre. Ich stöhnte, in Ordnung wäre nach meiner Auffassung nicht zusätzlich zum Krebs am Darm nun auch noch Knoten in der Brust zu haben, was ich aber nicht sagte. Der Oberarzt äußerte, dass ich mich richtig entschieden hätte, als ich am Mamascreening teilnahm. So einleuchtend war mir dies nicht, schließlich ist die Prognose für meine Art des Darmkrebses keineswegs so toll. Die beiden Knoten in der Brust würden meine Chancen nicht verringern, war die Antwort. Das hörte ich gern. Falls der Befund ungünstig und eine weitere Operation nötig wäre, dann wollte ich eine zweite Meinung. Der Doktor fand dies völlig korrekt. An meiner Stelle würde er es genauso verlangen. Solche Äußerungen erhöhten natürlich mein Vertrauen in diesen Arzt.
Die Doktorin führte mich in ein anderes Zimmer. Dort erläuterte sie mir, dass der Sentinel oder Wächterlymphknoten ebenfalls bei der OP entfernt wird. Am Operationstag müsste ich zur Strahlenmedizin fahren, wo man den Lymphknoten markieren würde. Dazu würde mir schwach radioaktives Material gespritzt werden. Man wolle mich im Krankenhaus nicht einsperren. Ich könnte am Nachmittag draußen spazierengehen. Das klang gar nicht mehr so cool und ein wenig menschlicher. Auch ohne ihre Erlaubnis hätte ich mich auf den Weg gemacht. Im Patientenzimmer würde ich mich schließlich lange genug aufhalten müssen.
Mein letztes Date an diesem Tag hatte ich mit dem Anästhesisten. Zu dieser Verabredung musste ich ins Gebäude nebenan gehen. Auch hier war das Wartezimmer gut gefüllt und außerdem frostig wie ein Kühlschrank. Plötzlich kam ein kleiner junger Mann aus dem Besprechungsraum geschossen, stürzte zur Heizung und drehte diese auf. Im Nebenraum würde er nicht merken, wenn es hier kalt wäre, brummelte er entschuldigend. Dann war ich an der Reihe und hockte neben dem jungen Arzt am Schreibtisch. Er wollte wissen, warum ich gekommen wäre. Ich antwortete, dass an mir ein wenig herumgeschnippelt werden sollte. Der Anästhesist warf einen Blick in meine Akte und bemerkte, bei dem, was ich schon hinter mir hätte, wäre es wirklich nur ein wenig Geschnippel.
Als ich endlich im Patientenzimmer am Tisch saß und das von der Schwester in der Mikrowelle aufgewärmte Hühnerfrikassee aß, war es mittlerweile nachmittags halb vier. Ich machte mich auf den Weg zur Dompassage. Die meisten Konsumtempel dieser Art unterscheiden sich nicht voneinander, Klamottenläden, Fressstände, Mediamärkte über mehrere Etagen. Alles ist austauschbar und doch so gleichartig, dass man kaum weiß, in welcher Stadt man sich eigentlich befindet. Die Greifswalder Dompassage ist in ihrer Form einzig, weil sie gegenüber der Chirurgischen Klinik zwischen zwei Häuserzeilen hineingepresst wurde und noch potthässlicher ist, als die anderen Konsumtempel. Ich hielt mich dort auch nur im Zeitungsladen länger auf, allerdings ohne etwas interessantes zu finden. Am Backstand studierte ich die Kuchenpreise, die mir noch annehmbar erschienen. Bei meinem Bäcker um die Ecke ist der Preis für einen Liebesknochen von ursprünglich 80 Cent auf 1,25 Euro gestiegen. Ich kaufe dort nicht mehr. Und hier in der Dompassage erstand ich auch nichts weiter als eine Tafel Bitterschokolade.
Ich flanierte lieber im kleinen Park, den die Mauern der Frauenklinik und die Zäune des Greifswalder Tierparks eingrenzen, bevor ich in die dunkelrote Trutzburg Frauenklinik zurückkehrte. Der nächste Tag würde der Operationstag sein. Ich schlief die Nacht unruhig aber traumlos.
Sonntag, 6. Mai 2007
Neue Ängste
Sonntag, 6. Mai 2007, Kategorie: 'Krankengeschichten'
Letzten Sonntag hatte ich den seltenen Luxus nicht allein frühstücken zu müssen. Meine Tante und mein Onkel, die auf Usedom Urlaub machen wollten, tauchten hier auf mit frischen Brötchen im Gepäck. Sie waren schon kurz nach sechs Uhr von Berlin losgefahren. Am Sonntagmorgen hatten sie um diese Zeit die Autobahn fast für sich allein.
Meine Tante wollte wissen, ob ich mich schon groß sorgen würde, wegen meines OP-Termins nächste Woche in Greifswald. Ich verneinte und erklärte, darüber noch keinen Gedanken zu verlieren. Das würde ich erst am drauffolgenden Wochenende tun, also jetzt. Bis dahin ließe sich der Schrecken hervorragend verdrängen. Ohne diese Möglichkeit würde ich doch durchdrehen. Es wäre für mich unerträglich andauernd Todesfurcht zu haben. Ich habe festgestellt, dass sich mit der Zeit auch die Angst abnutzt wie ein alter Socken. Es ist gut, dass ich sie ab und zu beiseite schieben kann.
Nach den Verwandten erschien mein Bruder, fuhr mich nach Berlin und lud mich bei einer anderen Tante und einem anderen Onkel in Köpenick ab. Sie hatten sich bereit erklärt, mich am Montag zum Proktologen zu fahren. Aber sehr weit kamen wir an diesem Tag nicht. Erstmal standen wir über eine Stunde hoffnungslos im Stau zwischen anderen Autos eingekeilt. Die Dame vom Regionalsender unterrichtete ihre Hörer über fünfzehn Minuten Wartezeit an dieser Stelle. Im Radio laufen die Uhren anders. Ich musste mein Handy zücken und die Verspätung melden. Das Krankenhaus, in dem ich den Termin zur Sprechstunde hatte, lag im Westteil Berlins. Die üblichen Einkaufsmärkte gab es hier nicht sondern eine Schlossstraße. Das klang ein bisschen nach Monopoly. Kein Wunder Steglitz-Zehlendorf ist nach der Wikipedia die teuerste Wohngegend Berlins mit entsprechender Sozialstruktur und wohl auch eine der schönsten. Vor allem Villen und Bäume prägen ihren parkähnlichen Charakter.
Das Krankenhaus befand sich unweit einer U-Bahnstation. Ich war spät dran und erschien eine Stunde nach dem vereinbarten Termin. Trotzdem erhielt ich bei der Patientenannahme das übliche Papier zum Ausfüllen. Die erste Frage bei der Anmeldung lautete, ob ich Privatpatientin wäre oder eine Extraversicherung mit Chefarztbehandlung hätte. Wäre die Lösung für mein Problem dann ein anderes gewesen? Ich bin ganz normal gesetzlich krankenversichert ohne jegliche Extravaganzen.
Der weißhaarige ältere Herr, der mich empfing, war in diesem seinem Fachgebiet seit vierzig Jahren tätig, wie er berichtete. Auch er begutachtete meinen Anus. Im Gegensatz zu Neubrandenburg, wo ich dazu seitlich auf einem Tisch liegen musste, saß ich hier auf einem Stuhl wie beim Frauenarzt. Mein Hintern wurde hochgefahren. Sonst war die Untersuchung genauso unangenehm wie immer. Da unten wäre alles sehr eng und vernarbt, erfuhr ich. Hilfe sei in meinem Fall weder medikamentös noch anderwärtig möglich. Wie sehr ich unter meinem rückseitigen Flammenwerfer leide, blieb dem alten Arzt nicht verborgen. Die beste Lösung dem Pavianhintern und den Durchfällen zu entgehen wäre für mich ein neues dann endständiges Stoma.
Buh, auch das noch! Ich muss mich nicht gleich entscheiden. Im Moment habe ich einfach zuviele negative Nachrichten zu verkraften. Ich möchte nur wissen, warum der Chirurg in Greifswald mir nicht die Wahrheit sagte. Bevor er meinen Darm zurückverlegte, hatte ich ihn gefragt, ob mir ein rotentzündeter Po mit vielen Toilettengängen drohen würden. Die Antwort war nein gewesen. Den blutigen Hintern hat auch nicht er, sondern ich habe den jetzt.
Das beste Gespräch an jenem Wochenende hatte ich ganz unerwartet mit dem Mann meiner Kusine. Er sagte mir, die neuerliche Krebserkrankung im Sinn, ich solle nicht glauben, dies wäre jetzt das Ende. Ist es nicht? Als Beispiel schilderte er mir das Schicksal eines Arbeitskollegen. Der litt an schwerem Diabetes, bekam Krebs und hatte zu allem Übel zwei schlimme Unfälle. Das wäre nun fünfzehn Jahre her. Der Mann sei inzwischen verheiratet, es ginge ihm gut, und man würde ihm seine Erkrankung nicht ansehen. Allein zu sein, wäre ungesund für mich. Mein Schwiegerkusin riet mir, unter die Leute zu gehen. Mit diesem Hintern ist das ein recht heikles Unterfangen. Der Mann meiner Kusine sagte mir, oft säße er hier auf der Terrasse und sei glücklich, wenn die Vögel zwitscherten. Die meisten Leute könnten sich an kleinen Dingen gar nicht mehr erfreuen.

Ich kann das noch. Den Rest des Maifeiertages verbrachte ich im Garten meiner Eltern. Ich saß mit Jutta plauschend im Liegestuhl, ließ mir die Sonne ins Gesicht scheinen und sog tief den betörenden Duft ein, der von den Fliederbüschen zu uns herüberschwappte. Über den Rasen hüpfte, die Flügel aufgeregt um sich schlagend, ein Amselmännchen. "Komm mal her," sagte meine Stiefmutter zu dem Winzling im schwarzen Anzug. Der wippte mit dem Schwänzchen und kam doch tatsächlich über den Rasen zu uns herübergehoppelt. Auf der Terasse vor unseren Liegestühlen stehend reckte er seinen leuchtend gelben Schnabel in die Höhe. Von dem vorgetragenen Gezwitscher verstand ich leider kein Wort. Aber es klang sehr laut und sehr bedeutend. An diesem Nachmittag im Garten vergaß ich meinen übergroßen Kummer.

Jetzt bin ich wieder zu Hause, allein mit mir und meinen Ängsten. Neben meinem Notebook steht eine Vase mit weißen und dunkelvioletten Flieder aus dem elterlichen Garten, den Jutta für mich geflückt hat. Ich liebe Flieder über alle Maßen. Obwohl dieser hier schon langsam welkt, duftet er noch immer.
So, meine Lieben, dies ist erst mein zweiter Artikel im neuen Weblog, und schon muss ich wieder aufhören. Wie lange ich in der Greifswalder Frauenklinik bleiben muss, weiß ich noch nicht genau. Drückt mir die Daumen!
 6,9 MB
6,9 MB
Meine Tante wollte wissen, ob ich mich schon groß sorgen würde, wegen meines OP-Termins nächste Woche in Greifswald. Ich verneinte und erklärte, darüber noch keinen Gedanken zu verlieren. Das würde ich erst am drauffolgenden Wochenende tun, also jetzt. Bis dahin ließe sich der Schrecken hervorragend verdrängen. Ohne diese Möglichkeit würde ich doch durchdrehen. Es wäre für mich unerträglich andauernd Todesfurcht zu haben. Ich habe festgestellt, dass sich mit der Zeit auch die Angst abnutzt wie ein alter Socken. Es ist gut, dass ich sie ab und zu beiseite schieben kann.
Nach den Verwandten erschien mein Bruder, fuhr mich nach Berlin und lud mich bei einer anderen Tante und einem anderen Onkel in Köpenick ab. Sie hatten sich bereit erklärt, mich am Montag zum Proktologen zu fahren. Aber sehr weit kamen wir an diesem Tag nicht. Erstmal standen wir über eine Stunde hoffnungslos im Stau zwischen anderen Autos eingekeilt. Die Dame vom Regionalsender unterrichtete ihre Hörer über fünfzehn Minuten Wartezeit an dieser Stelle. Im Radio laufen die Uhren anders. Ich musste mein Handy zücken und die Verspätung melden. Das Krankenhaus, in dem ich den Termin zur Sprechstunde hatte, lag im Westteil Berlins. Die üblichen Einkaufsmärkte gab es hier nicht sondern eine Schlossstraße. Das klang ein bisschen nach Monopoly. Kein Wunder Steglitz-Zehlendorf ist nach der Wikipedia die teuerste Wohngegend Berlins mit entsprechender Sozialstruktur und wohl auch eine der schönsten. Vor allem Villen und Bäume prägen ihren parkähnlichen Charakter.
Das Krankenhaus befand sich unweit einer U-Bahnstation. Ich war spät dran und erschien eine Stunde nach dem vereinbarten Termin. Trotzdem erhielt ich bei der Patientenannahme das übliche Papier zum Ausfüllen. Die erste Frage bei der Anmeldung lautete, ob ich Privatpatientin wäre oder eine Extraversicherung mit Chefarztbehandlung hätte. Wäre die Lösung für mein Problem dann ein anderes gewesen? Ich bin ganz normal gesetzlich krankenversichert ohne jegliche Extravaganzen.
Der weißhaarige ältere Herr, der mich empfing, war in diesem seinem Fachgebiet seit vierzig Jahren tätig, wie er berichtete. Auch er begutachtete meinen Anus. Im Gegensatz zu Neubrandenburg, wo ich dazu seitlich auf einem Tisch liegen musste, saß ich hier auf einem Stuhl wie beim Frauenarzt. Mein Hintern wurde hochgefahren. Sonst war die Untersuchung genauso unangenehm wie immer. Da unten wäre alles sehr eng und vernarbt, erfuhr ich. Hilfe sei in meinem Fall weder medikamentös noch anderwärtig möglich. Wie sehr ich unter meinem rückseitigen Flammenwerfer leide, blieb dem alten Arzt nicht verborgen. Die beste Lösung dem Pavianhintern und den Durchfällen zu entgehen wäre für mich ein neues dann endständiges Stoma.
Buh, auch das noch! Ich muss mich nicht gleich entscheiden. Im Moment habe ich einfach zuviele negative Nachrichten zu verkraften. Ich möchte nur wissen, warum der Chirurg in Greifswald mir nicht die Wahrheit sagte. Bevor er meinen Darm zurückverlegte, hatte ich ihn gefragt, ob mir ein rotentzündeter Po mit vielen Toilettengängen drohen würden. Die Antwort war nein gewesen. Den blutigen Hintern hat auch nicht er, sondern ich habe den jetzt.
Das beste Gespräch an jenem Wochenende hatte ich ganz unerwartet mit dem Mann meiner Kusine. Er sagte mir, die neuerliche Krebserkrankung im Sinn, ich solle nicht glauben, dies wäre jetzt das Ende. Ist es nicht? Als Beispiel schilderte er mir das Schicksal eines Arbeitskollegen. Der litt an schwerem Diabetes, bekam Krebs und hatte zu allem Übel zwei schlimme Unfälle. Das wäre nun fünfzehn Jahre her. Der Mann sei inzwischen verheiratet, es ginge ihm gut, und man würde ihm seine Erkrankung nicht ansehen. Allein zu sein, wäre ungesund für mich. Mein Schwiegerkusin riet mir, unter die Leute zu gehen. Mit diesem Hintern ist das ein recht heikles Unterfangen. Der Mann meiner Kusine sagte mir, oft säße er hier auf der Terrasse und sei glücklich, wenn die Vögel zwitscherten. Die meisten Leute könnten sich an kleinen Dingen gar nicht mehr erfreuen.

Ich kann das noch. Den Rest des Maifeiertages verbrachte ich im Garten meiner Eltern. Ich saß mit Jutta plauschend im Liegestuhl, ließ mir die Sonne ins Gesicht scheinen und sog tief den betörenden Duft ein, der von den Fliederbüschen zu uns herüberschwappte. Über den Rasen hüpfte, die Flügel aufgeregt um sich schlagend, ein Amselmännchen. "Komm mal her," sagte meine Stiefmutter zu dem Winzling im schwarzen Anzug. Der wippte mit dem Schwänzchen und kam doch tatsächlich über den Rasen zu uns herübergehoppelt. Auf der Terasse vor unseren Liegestühlen stehend reckte er seinen leuchtend gelben Schnabel in die Höhe. Von dem vorgetragenen Gezwitscher verstand ich leider kein Wort. Aber es klang sehr laut und sehr bedeutend. An diesem Nachmittag im Garten vergaß ich meinen übergroßen Kummer.

Jetzt bin ich wieder zu Hause, allein mit mir und meinen Ängsten. Neben meinem Notebook steht eine Vase mit weißen und dunkelvioletten Flieder aus dem elterlichen Garten, den Jutta für mich geflückt hat. Ich liebe Flieder über alle Maßen. Obwohl dieser hier schon langsam welkt, duftet er noch immer.
So, meine Lieben, dies ist erst mein zweiter Artikel im neuen Weblog, und schon muss ich wieder aufhören. Wie lange ich in der Greifswalder Frauenklinik bleiben muss, weiß ich noch nicht genau. Drückt mir die Daumen!
Samstag, 28. April 2007
Umzüge
Samstag, 28. April 2007, Kategorie: 'Krankengeschichten'
Der Anruf der Oberärztin kam Dienstagvormittag. Sie sagte mir, der zweite Pathologe glaubte einige bösartige Zellen erkannt zu haben. Am 7. Mai muss ich in die Greifswalder Frauenklinik einrücken. Einen Tag später werde ich operiert. "Am Tag der Befreiung", entfuhr es mir. Da werde ich dann ebenfalls befreit, von was auch immer. Hoffentlich können sich die Pathologen dann auf einen histologischen Befund einigen! Im Augenblick ist mir alles zuviel, und ich fühle mich einfach überfordert mit der Aussicht auf Doppelkrebs. Das ist purer Stress für mich, und meine Rückseite reagierte entsprechend. Der Flammenwerfer arbeitet wieder.
Dieses Problems wegen war ich Montag erneut von Beate begleitet, auf eigenen Wunsch aber mit Überweisung vom Hausarzt, in Neubrandenburg beim Proktologen. Er war der am dichtesten residierende Spezialist für Krankheiten des Enddarms. Seine Praxis hatte er in einem Wohnblock der Oststadt. Ich glaubte erst, wir hätten uns verfahren. Denn das Haus gegenüber war bis auf einige wenige Wohnungen fast leergezogen. Sanierung oder ein Fall für die Abrissbirne? Neubrandenburg hat nach der Wende mehr als 20.000 seiner Einwohner verloren. Zum Glück für mich war dieser Arzt nicht darunter. Der nächste Mediziner dieses Fachgebiets sitzt noch weiter weg in Güstrow.
Meine Darmuntersuchungen sind noch nie so lustig gewesen, wie sie Sebas in seiner „Ode an meine Proktologin.“ beschreibt. Es ist einfach der Unterschied zwischen Hämorrhoiden ersten Grades und Darmkrebs Stadium drei. Aber meine Krankheit hat auch ihre positiven Seiten. Ich habe kein Druckproblem und stehe nicht "under pressure". Zum Lachen war mir beim Hinterncheck nicht. Es war immens unangenahm, tat weh wie immer, und ich lief aus. Die Schwester hatte ein wenig zu wischen. Ob mein Schließmuskel schon mal vermessen worden wäre, oder mein After ultrabeschallt, fragte mich der Doktor. Weder noch. Er schrieb mir eine Überweisung an Berliner Kollegen aus.
Seine schwierigen Fälle würde er immer dorthin schicken. Die Fahrt nach Berlin muss ich selbst bezahlen, die Kosten der Untersuchungen trägt dann die Krankenkasse. So schnell bin ich noch nie zu einer Überweisung zum Spezialisten gekommen. Gewöhnlich doktoren die Ärzte doch immer an ihren Patienten herum, ehe sie diese weiterreichen. Die Schwester im Vorzimmer organisierte mir per Telefon den Termin. Zu laut, wie Beate meinte, die im Wartezimmer saß. Nun weiß ganz Neubrandenburg über meine Stuhlinkontinenz bescheid.
Inkontinent bin ich nicht immer. Es ist mehr eine Frage des Aggregatzustandes. Ostern konnte ich sogar mit dem Familienclan durch Hellersdorf spazieren. Im Moment wär das nicht möglich. Mein Onkologe konnte beim besten Willen keinen Sinn in meinem Wunsch nach proktologischer Beratung entdecken. Mein Dünndarm wäre strahlengeschädigt, mein Mastdarm perdu, es wird nie mehr so sein, wie es war. Basta! Nur ich kann mich nicht damit abfinden den Rest meiner Tage im stillen Örtchen thronend zu verbringen. Der Schließmuskel scheint ja noch halbwegs intakt zu sein. Mir wäre schon geholfen, wenn ich statt 10-15 nur noch 5 Mal rennen müsste. Vielleicht ist ja auch ein neuerliches Stoma die Lösung. Mit Ruhe und Auskurrieren ist es wieder Essig! Meine Krankheit sorgt einmal mehr für die nötige Unterhaltung, erst Enddarm dann Brust.
Aber ich belege nicht nur für kurze Zeit ein hübsches Krankenbett in der Uniklinik Greifswald, auch hier in meinen Weblog und dem Podcast tut sich einiges. Ich gebe meine Domain nach genau fünf Jahren auf, hauptsächlich des schnöden Mammons wegen. Meine Rente ist nur klein, und statt in dieses Webpack investiere ich sie besser in Toilettenpapier. Im Augenblick habe ich gar kein Einkommen, denn die Erwerbsminderungsrente, obwohl ab Dezember zugesichert, wird das erste Mal Ende Juni gezahlt. Die Beiträge der ersten sechs Monate behält der Rentenversicherer ein, um sie mit anderen Behörden zu verrechnen. Anschließend erhalte ich den Rest. Das ist nicht nur bei mir so, sondern gilt für alle Erwerbsminderungsrentner gleichermaßen. Wem bis dahin die Puste ausgehen sollte, und, vorausgesetzt sein Vermögen beträgt nicht mehr als 2.600 Euronen, der erhält Grundsicherung vom Sozialamt. Dies ist noch einen Zahn schärfer als Hartz IV.
Nun gut, das Finanzielle ist ein Grund, aber bei weitem nicht der einzige. Meinem Thema geschuldet trete ich hier Details meiner Krankengeschichte breit. Es hat mich schon immer gestört, dass ich als Besitzer einer eigenen Domain meine Adresse preisgeben muss. Mein Blog hier ist ja keine Zeitung. Ich schreibe in erster Linie mir die Ängste von der Seele und dann für meine Familie, die Freunde, die Arbeitskollegen, andere wie auch immer Betroffene. Obgleich im Web weltweit erreichbar ist das kein hinreichender Grund zum Outing. Meine Leser- bzw. Hörerschaft ist nur klein. Eine Krebserkrankung mit ihren Höhen und Tiefen ist keine massenkompatible Angelegenheit. Bekannt zu werden ist auch nicht der Antrieb meines Tuns. Mit meinen Geschichten will ich nicht ins Licht der Aufmerksamkeit gezerrt werden, um irgendjemandes Voyeurismus zu bedienen. Der Grad zwischen öffentlichem Bekenntnis und Privatheit ist sehr schmal. Ich versuche eine gewisse Balance zu halten und nicht abzustürzen.
Weil das Bloggen und Podcasten meine Strategie ist, dem Krebs zu trotzen, habe ich mich nach Alternativen zur eigenen Domain umgesehen. Zum Glück gibt es ja genügend Bloghoster, die Software und kostenlosen Speicherplatz anbieten. Ab Mai werde ich dann unter der Gemeinschaft von blogger.de meine Artikel ins Netz stellen. Blogger.de lag nahe, weil dort einige von mir geschätzte Damen und Herren bloggen, und ich selber schon Mitglied der Gemeinde war. Ein geeignetes Kleid fürs Weblog habe ich auch gefunden und angepasst. Von den 205 Artikel aus den alten Nordlichtern habe ich 100 übernommen. Der Orginalzeitpunkt, an dem ich die Artikel ursprünglich veröffentlicht habe, steht in Klammern darunter. Die Kommentarfunktion habe ich für diese Einträge abgeschaltet. Ich hoffe, Ihr besucht mich dann ab 1. Mai im neuen Weblog unter „http://mariont.blogger.de“.
Von den Hörern meines Podcastes verabschiede ich mich vorerst. Zwar habe ich auch für meinen Podcast "Nachtgedanken" einen neuen Platz gefunden, nur das Hochladen der 95 alten Episoden wird länger dauern. Der Podcast ist dann unter „http://nachtgedanken.podspot.de“ zu erreichen. Im Moment ist er noch leer.
Ich will Euch auch nicht verschweigen, dass ein weiterer Anlass meine Domain aufzugeben die geringe Rückmeldung war, die ich erhielt. Manchmal glaubte ich, ich redete gegen eine Wand. Die warf mir nur meiner eigenen Stimme zurück und sonst nichts. Nun denn, neues Weblog, neuer Krebs, neues Glück? Bis bald meine Lieben!
Dieses Problems wegen war ich Montag erneut von Beate begleitet, auf eigenen Wunsch aber mit Überweisung vom Hausarzt, in Neubrandenburg beim Proktologen. Er war der am dichtesten residierende Spezialist für Krankheiten des Enddarms. Seine Praxis hatte er in einem Wohnblock der Oststadt. Ich glaubte erst, wir hätten uns verfahren. Denn das Haus gegenüber war bis auf einige wenige Wohnungen fast leergezogen. Sanierung oder ein Fall für die Abrissbirne? Neubrandenburg hat nach der Wende mehr als 20.000 seiner Einwohner verloren. Zum Glück für mich war dieser Arzt nicht darunter. Der nächste Mediziner dieses Fachgebiets sitzt noch weiter weg in Güstrow.
Meine Darmuntersuchungen sind noch nie so lustig gewesen, wie sie Sebas in seiner „Ode an meine Proktologin.“ beschreibt. Es ist einfach der Unterschied zwischen Hämorrhoiden ersten Grades und Darmkrebs Stadium drei. Aber meine Krankheit hat auch ihre positiven Seiten. Ich habe kein Druckproblem und stehe nicht "under pressure". Zum Lachen war mir beim Hinterncheck nicht. Es war immens unangenahm, tat weh wie immer, und ich lief aus. Die Schwester hatte ein wenig zu wischen. Ob mein Schließmuskel schon mal vermessen worden wäre, oder mein After ultrabeschallt, fragte mich der Doktor. Weder noch. Er schrieb mir eine Überweisung an Berliner Kollegen aus.
Seine schwierigen Fälle würde er immer dorthin schicken. Die Fahrt nach Berlin muss ich selbst bezahlen, die Kosten der Untersuchungen trägt dann die Krankenkasse. So schnell bin ich noch nie zu einer Überweisung zum Spezialisten gekommen. Gewöhnlich doktoren die Ärzte doch immer an ihren Patienten herum, ehe sie diese weiterreichen. Die Schwester im Vorzimmer organisierte mir per Telefon den Termin. Zu laut, wie Beate meinte, die im Wartezimmer saß. Nun weiß ganz Neubrandenburg über meine Stuhlinkontinenz bescheid.
Inkontinent bin ich nicht immer. Es ist mehr eine Frage des Aggregatzustandes. Ostern konnte ich sogar mit dem Familienclan durch Hellersdorf spazieren. Im Moment wär das nicht möglich. Mein Onkologe konnte beim besten Willen keinen Sinn in meinem Wunsch nach proktologischer Beratung entdecken. Mein Dünndarm wäre strahlengeschädigt, mein Mastdarm perdu, es wird nie mehr so sein, wie es war. Basta! Nur ich kann mich nicht damit abfinden den Rest meiner Tage im stillen Örtchen thronend zu verbringen. Der Schließmuskel scheint ja noch halbwegs intakt zu sein. Mir wäre schon geholfen, wenn ich statt 10-15 nur noch 5 Mal rennen müsste. Vielleicht ist ja auch ein neuerliches Stoma die Lösung. Mit Ruhe und Auskurrieren ist es wieder Essig! Meine Krankheit sorgt einmal mehr für die nötige Unterhaltung, erst Enddarm dann Brust.
Aber ich belege nicht nur für kurze Zeit ein hübsches Krankenbett in der Uniklinik Greifswald, auch hier in meinen Weblog und dem Podcast tut sich einiges. Ich gebe meine Domain nach genau fünf Jahren auf, hauptsächlich des schnöden Mammons wegen. Meine Rente ist nur klein, und statt in dieses Webpack investiere ich sie besser in Toilettenpapier. Im Augenblick habe ich gar kein Einkommen, denn die Erwerbsminderungsrente, obwohl ab Dezember zugesichert, wird das erste Mal Ende Juni gezahlt. Die Beiträge der ersten sechs Monate behält der Rentenversicherer ein, um sie mit anderen Behörden zu verrechnen. Anschließend erhalte ich den Rest. Das ist nicht nur bei mir so, sondern gilt für alle Erwerbsminderungsrentner gleichermaßen. Wem bis dahin die Puste ausgehen sollte, und, vorausgesetzt sein Vermögen beträgt nicht mehr als 2.600 Euronen, der erhält Grundsicherung vom Sozialamt. Dies ist noch einen Zahn schärfer als Hartz IV.
Nun gut, das Finanzielle ist ein Grund, aber bei weitem nicht der einzige. Meinem Thema geschuldet trete ich hier Details meiner Krankengeschichte breit. Es hat mich schon immer gestört, dass ich als Besitzer einer eigenen Domain meine Adresse preisgeben muss. Mein Blog hier ist ja keine Zeitung. Ich schreibe in erster Linie mir die Ängste von der Seele und dann für meine Familie, die Freunde, die Arbeitskollegen, andere wie auch immer Betroffene. Obgleich im Web weltweit erreichbar ist das kein hinreichender Grund zum Outing. Meine Leser- bzw. Hörerschaft ist nur klein. Eine Krebserkrankung mit ihren Höhen und Tiefen ist keine massenkompatible Angelegenheit. Bekannt zu werden ist auch nicht der Antrieb meines Tuns. Mit meinen Geschichten will ich nicht ins Licht der Aufmerksamkeit gezerrt werden, um irgendjemandes Voyeurismus zu bedienen. Der Grad zwischen öffentlichem Bekenntnis und Privatheit ist sehr schmal. Ich versuche eine gewisse Balance zu halten und nicht abzustürzen.
Weil das Bloggen und Podcasten meine Strategie ist, dem Krebs zu trotzen, habe ich mich nach Alternativen zur eigenen Domain umgesehen. Zum Glück gibt es ja genügend Bloghoster, die Software und kostenlosen Speicherplatz anbieten. Ab Mai werde ich dann unter der Gemeinschaft von blogger.de meine Artikel ins Netz stellen. Blogger.de lag nahe, weil dort einige von mir geschätzte Damen und Herren bloggen, und ich selber schon Mitglied der Gemeinde war. Ein geeignetes Kleid fürs Weblog habe ich auch gefunden und angepasst. Von den 205 Artikel aus den alten Nordlichtern habe ich 100 übernommen. Der Orginalzeitpunkt, an dem ich die Artikel ursprünglich veröffentlicht habe, steht in Klammern darunter. Die Kommentarfunktion habe ich für diese Einträge abgeschaltet. Ich hoffe, Ihr besucht mich dann ab 1. Mai im neuen Weblog unter „http://mariont.blogger.de“.
Von den Hörern meines Podcastes verabschiede ich mich vorerst. Zwar habe ich auch für meinen Podcast "Nachtgedanken" einen neuen Platz gefunden, nur das Hochladen der 95 alten Episoden wird länger dauern. Der Podcast ist dann unter „http://nachtgedanken.podspot.de“ zu erreichen. Im Moment ist er noch leer.
Ich will Euch auch nicht verschweigen, dass ein weiterer Anlass meine Domain aufzugeben die geringe Rückmeldung war, die ich erhielt. Manchmal glaubte ich, ich redete gegen eine Wand. Die warf mir nur meiner eigenen Stimme zurück und sonst nichts. Nun denn, neues Weblog, neuer Krebs, neues Glück? Bis bald meine Lieben!
... ältere Einträge

